Wo sind sie
geblieben ?














Der
„Flaschenhals" von Schlüsselburg
1942/43.
- Die Schlacht zwischen Leningrad und den Wolchow - Sümpfen
Im Herbst 1941 glaubte Hitler
noch, Leningrad aushungern zu können, aber schon im Frühjahr 1942 mußte er
erkennen, daß dies ein verhängnisvoller Fehler gewesen war. Die Stadt
kapitulierte nicht.
Nun erhielt Feldmarschall von
Manstein den Befehl, mit seiner 11. Armee, die gerade Sewastopol erobert
hatte, auch Leningrad zu Fall zu bringen. Die Mahnungen der obersten deutschen
Führung, die 11. Armee im Süden zu belassen, trafen bei Hitler auf taube
Ohren. Er wollte Leningrad haben.
Feldmarschall von Manstein
entwickelte einen genialen und zugleich einfachen Platz. Mit drei Korps wollte
er von Süden her die sowjetischen Stellungen überrennen, am Stadtrand
anhalten und mit zwei Korps nach Osten eindrehen, die Newa überschreiten, um
so dann Leningrad einzudrücken.
Dieser Plan wurde durch den
Spionagering „Rote Kapelle" nach Moskau verraten, und Stalin handelte
sofort. Er konzentrierte an der Wolchow-Front alle Verbände: sechzehn Schützendivisionen,
neun Brigaden und fünf Panzerbrigaden. Mit dieser gewaltigen Streitmacht trat
er zum Gegenangriff an. Am 27. August 1942 stürmten seine Divisionen gegen
den deutschen „Flaschenhals" von Schlüsselburg. Zwölf Kilometer tief
kämpften sich die sowjetischen Divisionen nach Westen vor und kamen bis dicht
an die Kirow-Bahn heran. Der „Flaschenhals" war damit bis zur Mitte
eingeschnürt.
Angesichts dieser Lage blieb
Manstein nichts anderes übrig, als seine Leningrad-Offensive abzubrechen und
der hart bedrängten 18. deutschen Armee zu Hilfe zu kommen. In überaus
harten Kämpfen gelang es Mansteins Verbänden schließlich, die Russen zurückzuwerfen.
Der September und der Oktober
vergingen. Im November zeichnete sich bereits die Tragödie von Stalingrad ab.
Mansteins Armee fehlte nun im Süden. Ohne daß Manstein seine Aufgabe vor
Leningrad hätte erfüllen können, berief Hitler ihn und seine Armee ab. Der
Feldmarschall verließ die Bühne Leningrad und verschwand südwärts. Zurück
blieb Generaloberst Lindemanns 18. Armee, die sich eingrub, wahre
unterirdische Städte erbaute und im übrigen darauf wartete, was nun seitens
der Russen geschehen würde. Daß sich diese nach dem Abzug Mansteins die
Chance, erneut operativ zu werden, nicht entgehen lassen würden, darüber war
sich Lindemann klar.
Und so kam es auch. Am 12.
Januar 1943, bei arktischer Kälte und Schneesturm, griff der
Oberkommandierende der Wolchow-Front, General Goworow, den
„Flaschenhals" von Schlüsselburg zum zweitenmal an. Ein Trommelfeuer
aus über 4000 Rohren eröffnete die zweite Ladoga-Schlacht. Während die 2.
russische Stoßarmee von Osten her antrat, stürmten die Divisionen der 67.
Roten Armee über den Ladogasee und über die Newa gegen die deutschen
Verteidiger an. Fünf Schützendivisionen und eine Panzerbrigade allein im
Raum Marino-Gorodok gegen eine einzige deutsche Division, die 170. ID.

Das Ziel der zweiarmigen
sowjetischen Offensive war das gleiche wie das der ersten: Durchstoß bis zur
Kirow-Bahn und Einkesselung der 18. deutschen Armee.
Im Mittelpunkt dieser Kämpfe
standen in erster Linie die Regimenter der 170. und 227. Infanteriedivision.
Die russische Infanterie wurde schonungslos und in Massen eingesetzt, aber
alle Versuche, die schwache deutsche Verteidigungsfront zu durchbrechen, waren
vorerst zum Scheitern verurteilt. Zu Tausenden blieben die Sowjets im MG-Feuer
der Deutschen tot oder verwundet liegen. Schwache deutsche Bataillone kämpften
bis zum Umfallen gegen einen haushoch überlegenen Feind, und es sah schon
fast so aus, als müßte General Goworow erneut eine furchtbare Niederlage
hinnehmen. Da geschah das Unglück. Bei Marino, an der Nahtstelle zwischen der
AA 240 und dem II./GR 401, gelang den Russen der entscheidende Durchbruch in
die deutsche HKL
(Hauptkampflinie).
Generalmajor Duchanow, der
Oberbefehlshaber der 67. russischen Armee, erkannte die sich ihm bietende
Chance und pumpte alles, was er an Kräften freimachen konnte, in die
Durchbruchslücke. Im „Flaschenhals" von Schlüsselburg drohte das
Chaos auszubrechen. Gelang es Duchanow, die Stellungen der deutschen 170. ID
zu durchstoßen, dann stand er vor den beherrschenden Sinjawino-Höhen, und
der Weg zur Kirow-Bahn und ins rückwärtige Gebiet der 18. deutschen Armee
war für ihn frei.
Generaloberst Lindemann, ein
illusionsloser Armeeführer, sah sich in diesem kritischen Moment gezwungen,
seine einzige Reserve, die kampferprobte 96. ID - die freilich nur aus 5
Bataillonen bestand -, ins Gefecht zu werfen. Schweres feindliches
Artilleriefeuer, das Tag und Nacht hindurch anhielt, und die schwierigen Geländeverhältnisse
machten jedoch einen sofortigen Gegenstoß unmöglich und verzögerten diesen
um ganze 24 Stunden. Anstatt schon am 12. Januar in den Kampf einzugreifen, mußte
die 96. ID bis zum Morgen des 13. Januar warten.
Über dem Sumpf-, Wald- und
Steppengebiet südlich von Leningrad liegt das undurchdringliche Dunkel der
Januarnacht. Ununterbrochen knirschen die Räder der Lastautos und die
eisernen Reifen zweirädriger Pferdewagen über die holprigen Wege und
Nachschubstraßen. An den Kreuzungen stehen vermummte, vor Kälte schlotternde
Verkehrsposten und winken schweigend mit ihren kleinen, abgedunkelter.
Laternen.
Wie schon einmal, rollen auch
heute wieder Artillerie, Infanterie und Panzer aus dem Raum Leningrad zur
Newa-Front. Über Glatteis und durch metertiefe Schneeverwehungen quälen sich
riesige Transportlastwagen» gepanzerte Mannschaftswagen, verhüllte Geschütze,
modernste Flak
(Fliegerabwehrkanonen), gedrungene T-34 Panzer und, an die
Laster angekoppelt, kleine Pak
(Panzerabwehrgeschütze).
Immer wieder entstehen
kilometerlange Stauungen. Offiziere eilen herbei, fluchen, kommandieren.
Motoren heulen auf, Peitschenschläge knallen, und auf geheimnisvolle Weise
entwirrt sich die endlose Schlange wieder, strebt an bestimmten markierten
Punkten in verschiedene Richtungen auseinander.
In dieser turbulenten Bewegung
von Menschen, Motoren und Waffen ist eine Energie zu spüren, die sich schon
bei der ersten Belagerung von Leningrad in fast übermenschlicher Ausdauer
manifestierte.
Dieselben Truppenbewegungen
unter nicht minder harten Witterungsbedingungen vollziehen sich zur Stunde
auch im Osten der Wolchow-Front und auf dem meterdicken Eis des Ladogasees.
Insgesamt drei voll- und neuausgerüstete, mit den modernsten Waffen
ausgestattete Sowjetarmeen marschieren auf, um zwischen Schlüsselburg, Lipka
und Sinjawino den sogenannten deutschen Flaschenhals zu durchstoßen und die
deutsche 18. Armee zu vernichten. Nach Stalins Willen soll den Deutschen eine
vernichtende Niederlage zuteil werden. Der Zeitpunkt hierfür ist so günstig
wie noch nie zuvor. Überall im Osten ist die deutsche Front überdehnt und
besteht - man schreibt den 11. Januar 1943 - aus mehr oder minder
zusammengekratzten Verbänden, die zu werfen nach Ansicht des sowjetischen
Oberkommandos jetzt die Stunde gekommen ist.
Bei Rschew, bei Welikije Luki
und Demjansk, um nur einige gefährdete Frontabschnitte zu nennen, geht es um
die Existenz von ganzen Armeen. Sie stehen schon seit Wochen in schweren,
blutigen und verlustreichen Abwehrkämpfen und werden, darüber ist sich der
STAWKA
(Sowjetisches Oberkommando)
im klaren, keine Hilfestellung geben können,
wenn der Sturm südlich des Ladogasees losbrechen wird.
Es ist kurz nach Mitternacht,
als die Lagebesprechung im Gefechtsstand der 45.Gardeschützendivision zu Ende
geht
(nach sowjetischen
Dokumentationen).
In der Enge der Bauernkate, die
Generalmajor A. A. Krasnow als Gefechtsstand dient, ist die Luft zum zerneiden
dick. Der Zigarettenqualm hängt wie eine Wolke unter der niedrigen
Balkendecke.
Zwei Stunden wurden dazu
verwendet, Detailfragen des für den kommenden Morgen angesetzten Angriffs aus
dem kleinen Brückenkopf heraus zu erörtern. Ermüdende Einzelheiten, die
jedem Regimentskommandeur längst bekannt sind. Krasnow selbst, bekannt und
gefürchtet wegen seines temperamentvollen Wesens, hatte die Stabsbesprechung
mit einer für ihn ungewöhnlichen Sachlichkeit geführt. Außer General
Krasnow ist nämlich noch ein zweiter ranghoher Offizier anwesend: Matwejew,
Kriegsrat der Armee und eine der einflußreichsten Persönlichkeiten der
Heeresgruppe. Er hatte sich an der Lagebesprechung und der folgenden
Befehlsausgabe mit keinem Wort beteiligt, sondern war im Hintergrund
geblieben, auf einer Munitionskiste sitzend, scheinbar uninteressiert zuhörend.
Nachdem es wirklich nichts mehr
zu besprechen gibt, erwarten die Regimentskommandeure die übliche Schlußansprache
des Generals. Aber es kommt anders. General Krasnow dreht sich zum Kriegsrat
um, nickt diesem zu. Der steht auf und geht zum Kartentisch, legt die Hände
wortlos auf die Karte, so daß die eine westlich und die andere nördlich des
„Flaschenhalses" von Schlüsselburg liegt. Dann führt er beide langsam
nach vorn, bis dort, wo die Stadt Mga und die Kirow-Bahn eingezeichnet sind,
und vereinigt sie mit einem energischen Ruck.
Sie haben ihn verstanden:
Einschließung der deutschen 18. Armee von Westen und Norden.
Als Oberst Babschenko, 38 Jahre
alt und ein Hüne von Mann, von der Besprechung zurückkommt, gibt er seinem
Ordonnanzoffizier den Befehl, für drei Uhr alle Bataillonskommandeure
herzubeordern.
„Genosse Oberst, wir haben
ein Uhr nachts", wagt der Unterleutnant einzuwenden. „Wir feiern ein
Fest. Dazu ist es nie zu spät", erwidert der Oberst.
„Und nun verschwinden Sie
schon."
„Zu Befehl", erwidert
der Ordonnanzoffizier. Er läuft zum Nachrichtenbunker und ruft die
Bataillonsgefechtsstände an.
Im engen Unterstand des
Obersten sind auf einem Tisch Zeitungen ausgebreitet, auf denen einige
Feldflaschen mit Wodka und statt der Gläser säuberlich aufgeschnittene,
leere amerikanische Konservenbüchsen stehen.
Inzwischen sind alle
eingetroffen. Tartajow, der Major und dienstälteste Bataillonskommandeur, mit
der strengen Pünktlichkeit des alten Militärs, die anderen zwei Minuten früher
oder später. Hauptmann Sipjadom, der das II. Bataillon führt, kommt als
letzter mit fünf Minuten Verspätung an. Er war im Gefechtsstand noch
aufgehalten worden. Bei Sipjadoms Bataillon läuft derzeit eine Sonderaktion
der Pioniere, deren Ergebnis er noch abwarten wollte.
„Ich bitte wegen der Verspätung
um Verzeihung", entschuldigt sich der Hauptmann.
„Schon gut", winkt der
Oberst ein wenig herablassend ab. Er lädt die Kommandeure und Adjutanten ein,
sich einzuschenken. Als jeder versorgt ist, sagt er:
„Genossen, ich habe Sie zu
dieser ungewöhnlichen Stunde einberufen, um uns vor dem Angriff noch einmal
die Gelegenheit zu geben, beieinander zu sein und uns in die Augen zu sehen.
Vielleicht erleben wir nicht alle die Stunde des großen Sieges, aber die
Division, unser Regiment wird sie erleben. Trinken wir darauf. Es lebe die
Rote Armee. Es lebe der Sieg über die Faschisten."
Obgleich der Wodka gut und
reichlich ist, will keine Stimmung aufkommen. Selbst der Oberst kommt heute
nicht in Stimmung, so daß er schon nach einer Stunde zu seinen
Bataillonkommandeuren sagt:
„Freunde, es ist Zeit. In
wenigen Stunden geht es in den Kampf." Alle erheben sich. Er drückt
jedem die Hand, und einer nach dem anderen geht hinaus.
„Was Neues?" fragt der
Obergefreite Rupp um
sieben Uhr zehn seinen Kameraden, den Gefreiten Ernst Doren, als er ihn im
MG-Stand 9 ablöst.
Doren, durchgefroren und hundemüde,
antwortet: „Was soll's schon geben? Immer dasselbe." Er packt seine MPi
(Maschinenpistole), die vier Handgranaten, die er achtlos in sein Koppel
steckt, das Sturmgepäck.
„Ich geh' jetzt. Wenn's
Kaffee gibt, schick' ich dir eine Feldflasche nach vorn."
„Ist in Ordnung", sagt
Rupp. Er beobachtet, wie das bei jeder Wachablösung Vorschrift ist, mit dem
Fernglas das jenseits der Newa liegende Niemandsland, den Uferstreifen davor,
den zugefrorenen, tief verschneiten Fluß. Plötzlich stutzt er. Im Glas hat
er die gut erkennbaren russischen Stellungen. Merkwürdig ist das.
„He, Doren!" ruft er
nach dem Kameraden, der gerade um die Grabenecke biegen will. „Komm doch
noch mal her."
„Mann", sagt der
widerwillig und kehrt in den MG-Stand zurück. „Was ist jetzt wieder los,
Rupp? Ich bin müde, verstehst?? Müde und durchgefroren."
Rupp packt den Kameraden am Arm
und deutet feindwärts.
„Was ist los bei denen? Da
stimmt doch was nicht!"
„Was stimmt nicht?"
fragt Doren gereizt.
„Kein Schwanz zu sehen",
stößt Rupp erregt hervor. „Und die Landschaft drüben ist wie
ausgestorben. Wo die doch sonst um diese Zeit ihre Morgensuppe nach vorn
schleppen."
„Na ja", brummt Doren.
„Vielleicht haben sie ihr Frühstück um 'ne Stunde vorverlegt. Mir ist das
scheißegal."
Der Obergefreite Rupp setzt das
Glas ab und blickt Doren aus zusammengekniffenen Augen forschend an.
„Doren, du hast wieder mal
gepennt!" wirft Rupp seinem Kameraden vor. Dann nimmt er den Feldstecher
wieder hoch.
„Nun hör schon auf!"
unterbricht ihn Doren. „Ich hab' schlappgemacht. Geb's ja zu. Drei Wachen in
einer Nacht. Wer hält das aus?"
Rupp hatte einen leisen Pfiff
ausgestoßen. Als er jetzt sein Gesicht Doren zuwendet, ist er kreidebleich.
„Schau mal runter zum Fluß",
sagt er, drückt Doren das Fernglas in die Hand und schiebt ihn dicht an die
Brustwehr des MG-Standes.
Doren blickt durch das Glas.
Eine, zwei Sekunden Stille. Dann treten plötzlich Schweißperlen auf seine
Stirn.
„Das darf doch nicht wahr
sein", stammelt er. „Fußspuren auf der Newa: Dutzende. Sie ziehen sich
über den ganzen Fluß hin und enden direkt an der von der Kompanie
ausgelegten Draht- und Minensperre." Noch nie hatte der Gegner einen Fuß
über die Newa gesetzt. Die Sowjets verließen ihre Stellungen ebensowenig,
wie es die Grenadiere des Grenadierregiments 391 (GR 391) taten.
Feindseligkeiten tauschten nur die Artilleristen hüben und drüben aus.
„Glaubst du, die Russen haben
in der Nacht die Minen weggeräumt?" fragt der Gefreite Doren den
Kameraden kleinlaut.
„Wie soll ich das von hier
aus feststellen? Hol den Feldwebel her. Der Odenbach soll sich das selber
ansehen." „Ja, natürlich", murmelt Doren und hastet davon. Einige
Minuten später trifft Feldwebel Odenbach im MG-Stand 9 ein, halb angezogen.
Über den Strickpullover hat er sich rasch den Mantel geworfen. „Doren hat
mir schon gesagt, was los ist", kommt er der Meldung des Obergefreiten
zuvor. „Das Glas, Rupp!"
Ein kurzer Blick zum Fluß.
Dann sagt der Feldwebel: „Kriechen Sie bis zum Steilhang vor, Rupp!" Er
schnallt dem verdutzten Doren das Koppel ab und drückt das eine Ende Rupp in
die Hand, während er das andere festhält. „Los, jetzt! Und vorsichtig, daß
Sie nicht abrutschen."
Rupp kriecht mit vorsichtigen
Bewegungen auf die überhängende Schneewächte, die sich an dieser Stelle des
Steilufers gebildet hat, bis er einen Blick in die Tiefe werfen kann.
„Was sehen Sie?" ruft
ihm sein Zugführer ungeduldig und vor Kälte mit den Zähnen klappernd, zu.
„Komme zurück", antwortet der Obergefreite.
„Also?" fragt Odenbach,
als Rupp, krebsrot vor Anstrengung, sich auf die Grabensohle gleiten läßt.
„Alle Drahthindernisse
zerschnitten, Minen wahrscheinlich ausgebuddelt, und die spanischen Reiter
sind auseinandergezerrt, so daß überall breite Lücken sind", meldet
Rupp dem Feldwebel.
„Ist euch klar, was das
bedeutet?" fragt er Rupp und Doren, während seine Wangenmuskeln heftig
arbeiten. „Die Russen greifen heute an!" „Das kommt mir auch so vor,
Herr Feldwebel", pflichtet Rupp ihm bei. „MG schußklar halten und
Augen auf!" ermahnt Odenbach den Obergefreiten. „Und wenn's wirklich
losgeht, Rupp, Nerven behalten! Rankommen lassen bis auf zweihundert Meter.
Dann erst reinhalten. So, und jetzt muß der Chef verständigt und das
Bataillon benachrichtigt werden. Doren, Sie alarmieren inzwischen die Züge,
aber dalli, Mann."
Doren rennt los und spürt mit
einem Male keine Müdigkeit mehr. Außerdem ist er heilfroh, daß der
Feldwebel nicht gefragt hat, wieso die Spuren nicht schon eher entdeckt
wurden. Kurz darauf hat er den ersten Bunker erreicht, reißt die Tür auf und
brüllt hinein: „Alarm! Alarm!"
Fünf Minuten später gellen
die Trillerpfeifen im gesamten Verteidigungsabschnitt des I. Bataillons GR
391, das zur 170. Infanteriedivision gehört. Diese hat mit der Masse ihrer
Verbände den Newa-Abschnitt zwischen Dubrowka im Süden und Marino im Norden
zu verteidigen.
Weitere sieben Minuten später
- es ist sieben Uhr fünfunddreißig wird die Morgenstille an der Newa-Front,
im „Flaschenhals" von Schlüsselburg, von einem gewaltigen Donnerschlag
zerrissen.
4300 sowjetische Geschütze
aller Kaliber nehmen die Verteidigungsstellungen der 170. und 227. deutschen
Infanteriedivision unter Beschüß, die jeweils nur ganze 15 km lang sind. Das
bedeutet für einen Streifen von sechs Metern ein russisches Rohr. Es ist ein
Stahlgewitter, wie es die Landser hier oben im Norden seit Beginn des Krieges
noch nicht erlebt haben.
Die Welt südlich des
Ladogasees versinkt in Feuer, Rauch, Explosionsblitzen und hochgeschleuderten
Eis- und Schneemassen. Über 700 „Stalinorgeln"
(Raketengeschütze)
unterstützen die russische Artillerie, und die sowjetischen Kriegsschiffe im
Hafen von Leningrad feuern unentwegt ihre Breitseiten ab. Das tiefverschneite,
frostklirrende Land wird umgepflügt und in eine krachende, berstende Hölle
verwandelt.
Zwei Stunden und zwanzig
Minuten dauert dieser Feuerorkan, mit dem die Sowjets die 3. Ladoga-Schlacht
eröffnen.
„Diesmal wird's ernst",
sagen die Männer der 170. und 227. Infanteriedivision, die wehrlos in ihren
Kampfständen, Stützpunkten und Bunkern dem russischen Trommelfeuer
ausgesetzt sind.
Es sind zumeist gute, tief in
die Erde eingelassene Bunker. In anderthalb Jahren Leningrad- und
Wolchow-Krieg sind ganze unterirdische Städte entstanden, haben sich die
Grenadiere der beiden Infanteriedivisionen wie Maulwürfe in den Boden gewühlt.
Die Russen wissen das. Deshalb
haben sie ihre ganze verfügbare Artillerie in diesem Abschnitt
zusammengezogen, um die deutschen Stellungen zu zerschlagen. Sie leisten ganze
Arbeit und verlegen die Feuerwalze bis tief ins deutsche Hinterland. Es gibt
keine deutsche Batterie, die nicht unter schwerstem Beschuss liegt, keinen
Befehlsstand, der vom Feuerorkan verschont bleibt. Sogar die Querverbindungen
und Anmarschwege des XXVI. (26.) deutschen Armeekorps werden systematisch mit
einem Hagel von Granaten belegt.
Innerhalb kürzester Zeit sind
die meisten Telefonverbindungen zerstört. Die Störungssucher sausen los und
versuchen, zumindest die aller wichtigsten Fernsprechverbindungen
wiederherzustellen. Ein hoffnungsloses Unternehmen. Da helfen weder
Einsatzwille noch Kühnheit. Der Mensch wird zum hilflosen Wesen, das zusehen
muß, wie die entfesselte Technik mit grandioser, fast mathematischer Gründlichkeit
all das zerstört, was Menschenhände in Wochen und Monaten aufgebaut hatten.
Hinter der Wand aus Feuer und
Eisen stehen die russischen Angriffsdivisionen sprungbereit. Im Osten
Generalleutnant W. S. Romanowskis 2. sowjetische Stoßarmee mit sieben Schützendivisionen
und einer Panzerbrigade. Die deutsche Verteidigungsfront ist zirka 13
Kilometer breit und wird von der verstärkten 227. Infanteriedivision (227. ID)
unter
General von Scotti
verteidigt. Aus dem Westen - der Leningrad-Front -greift General Duchanows 67.
Armee an. Ihr gegenüber liegt die von General Sanders befehligte 170.
Infanteriedivision.
Das Operationsziel der Sowjets
ist für die deutsche Führung kein Geheimnis: Die Russen werden diesmal mit
allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln versuchen, den „Flaschenhals"
von Schlüsselburg, der die russische Landverbindung nach Leningrad
unterbindet, einzudrücken, um dann gemeinsam nach Süden bis zur Kirow-Bahn
durchzustoßen.
Die angelaufene Operation der
Sowjets ist nicht die erste dieser Art. Schon zweimal haben sie gewaltige
Anstrengungen unternommen, den deutschen Sperrriegel zu sprengen. Beide
Offensiven scheiterten unter blutigen Verlusten.
Was die jetzige Offensive von
den anderen unterscheidet, ist lediglich die Tatsache, daß es den Russen
gelungen ist, den riesigen Aufmarsch ihrer Truppen zu verbergen bzw. zu
verschleiern. Das Überraschungsmoment ist auf ihrer Seite.
Um den Obergefreiten Rupp
bricht die Hölle los. Einschlag liegt neben Einschlag. Der Lärm der
explodierenden Geschosse ist eine körperliche Marter ohnegleichen. Der
Obergefreite liegt auf der Grabensohle und preßt die Fäuste an die Ohren.
Das Getöse ist kaum auszuhalten.
Granaten zerhacken die Erde,
fetzen in den betonhart gefrorenen Boden. Die Splitter klirren gegen die
Grabenwände, dringen oft gar nicht durch und sausen als gefährliche
Abpraller kreuz und quer durch die Gegend.
Das ist kein gewöhnlicher
Feuerüberfall, sondern der Auftakt zu einer furiosen Vernichtungsschlacht.
Die Minuten dehnen sich zur
Ewigkeit. Und die Landser in den Gräben, Bunkern, MG-Ständen und Vorpostenlöchern
denken immer dasselbe: Es muß doch einmal aufhören. Doch der Feuerorkan
nimmt an Heftigkeit nicht ab, im Gegenteil, er steigert sich von Minute zu
Minute.
Der Verteidigungsbereich des I.
Bataillons liegt jetzt unter dem Beschuss mehrerer „Stalinorgel"-
Batterien. Die heulenden, ungleichmäßig und mit fürchterlichem Jaulen
einschlagenden Raketen sind schlimmer als die größten Artilleriebrocken; sie
entnerven einen Mann, lassen ihn beben vor Angst.
Nach vierzig Minuten verschiebt
sich die sowjetische Feuerwalze ostwärts in Richtung Gorodok, Elektrizitätswerk,
Ringstraße bis hinüber in den Abschnitt des Grenadierregiments 401 (GR 401)
und bis zu den Sinjawino-Höhen.
Das in Hunderten von Schlachten
geschulte Ohr der Grenadiere erkennt sofort, wenn das feindliche Feuer zurückverlegt
wird; selbst wenn diese Verschiebung nur unmerklich und raffiniert,
verschleiert (Einsatz starker Granatwerferverbände auf die vorderste HKL)
geschieht.


Das ist der Augenblick, in dem
der feindliche Angriff zu erwarten ist. Wehe dem Landser, der nicht
rechtzeitig hinter dem MG, hinterm Gewehr liegt. Die Russen kommen schnell,
sehr schnell. Und mancher Soldat, der das Artilleriefeuer heil überstanden
hat, büßt sein Leben ein, weil er vom Feind überrascht wird.
Der Obergefreite Rupp kennt die
Gefahr. Er reißt sich zusammen, schüttelt Dreck und Schnee ab und kauert
sich hinter das MG, das den Feuersturm wie durch ein Wunder heil überstanden
hat. Durchladen l Hebel auf Dauerfeuer! Und nun ein Blick durch die
Sichtblende.
Im gleichen Augenblick schlägt
unmittelbar vor dem MG-Stand ein Geschoß in den Boden. Der Luftsog der
explodierenden Granate schleudert den Obergefreiten gegen eine Munitionskiste.
Ein zweiter, brüllender
Einschlag, dicht neben dem ersten. Der MG-Stand geht in Fetzen. Die Balken
werden hoch in die Luft geschleudert.
„Ratsch-Bumm!"
registriert Rupp mechanisch. Das kurze, fauchende Geräusch des rasanten
Geschosses ist unverkennbar. Sie greifen an!
Als Rupp sich mit starken
Schmerzen im Rücken aufrichtet, stürzt Unteroffizier Eppler, sein Gruppenführer,
in den MG-Stand. Er brüllt dem Obergefreiten etwas zu, das dieser nicht
verstehen kann. „Ich bin wie taub!" schreit der Obergefreite zurück.
Eppler, mit hochrotem und schweißbedecktem Gesicht, jagt an Rupp vorbei, reißt
das Maschinengewehr hoch, das am Boden liegt, und befreit es von den schützenden
Lumpen. Sie wurden um das Schloß gewickelt, um ein Einfrieren desselben zu
verhindern. In diesem Moment gibt es eine fürchterliche Explosion.
Volltreffer!
„Deckung!" schreit Rupp.
Dann sieht er, wie der halbe
MG-Stand auf ihn zukommt, Schnee- und Eismassen, die auf ihn herabstürzen und
ihn zu begraben drohen, Rupp kennt solche Situationen. Er rudert wild mit
Armen und Beinen, und es gelingt ihm, sich aus dem Dreck- und Balkengewirr zu
befreien. Halb blind kriecht er einige Meter nach vorn, wo noch vor wenigen
Sekunden die Brustwehr war. Die russische Granate hat sie abrasiert, die Erde
ist wie eingeebnet.
Der Unteroffizier ist tot. Von
Granatsplittern durchsiebt, liegt er blutend im Schnee und hält mit seinen Fäusten
das Maschinengewehr fest. Da taucht plötzlich Feldwebel Odenbach im zertrümmerten
MG-Stand auf. Er übersieht mit einem Blick die Situation. Er zerrt die Leiche
aus dem MG-Stand. Zwei Landsern der 2. Gruppe, die eben durch den Stichgraben
stürzen, ruft er zu: „Schafft den Toten weg!"
In den engen Stellungsgräben
und Kampfständen ist weder Platz für Verwundete noch für Tote. Das
Hauptkampffeld muß frei sein. Das mag unmenschlich erscheinen, aber oft kam
es vor, daß die in die Gräben eingedrungenen Rotarmisten eigene und deutsche
Tote als Kugelfang vor sich auftürmten und als Deckung benutzten. Als
Feldwebel Odenbach in den MG-Stand zurückkommt, lehnt Rupp
mit kreidebleichem Gesicht da.
Er steht noch unter der Schockeinwirkung, das ist deutlich zu erkennen.
„Rupp, reißen Sie sich gefälligst
zusammen! Das MG in Stellung!"
Odenbachs befehlsgewohnte
Stimme und seine entschlossene Miene dulden keinen Widerspruch und auch keine
Schwäche. Rupp überwindet sein Entsetzen, packt das MG und bringt es an die
von Feldwebel Odenbach bezeichnete Stelle.
„Glauben Sie nur nicht, Rupp",
sagt Odenbach, während er eilig Schnee- und Eisklumpen mit den bloßen Händen
wegräumt, um dem MG das nötige Schußfeld zu geben, „daß mir so etwas
nicht auch an die Nieren geht. Aber wir dürfen jetzt nicht die Nerven
verlieren!"
„Tut mit leid, Herr
Feldwebel", sagt Rupp, „aber ich konnte den Anblick..."
„Schon in Ordnung."
Odenbach klopft dem bewährten Kameraden begütigend auf die Schulter.
„Einmal dreht jeder durch. Mir ging's nicht anders. Aber jetzt aufpassen,
die Russen werden gleich da sein. Ich schicke Ihnen Doren als Schütze zwei,
klar?"
„Ja, das wäre gut",
antwortet Rupp, während Odenbach davonstürzt.
Gegen alle Erwartungen bleibt
der Sturm auf die vorderste HKL des GR 391 noch aus. Zwar haben Sowjets in
Bataillonsstärke das Eis der Newa überschritten und sich bis an die
Drahthindernisse am diesseitigen Newa-Ufer herangearbeitet, den letzten
Schritt, die Überwindung des Steilufers, tun sie jedoch nicht.
Diese Verhaltensweise hat einen
besonderen Grund.
Obwohl General Duchanow, der
Oberkommandierende der 67. Armee, von der Wirkung seines schweren
Vernichtungsfeuers überzeugt ist, geht er dennoch auf Nummer Sicher. Er
spielt eine zweite Trumpfkarte aus: seine Jagd- und Schlachtfliegerverbände.
Er läßt die Geschwader genau in dem Augenblick los, als die Landser in dem
Glauben, das Artilleriefeuer glücklich überstanden zu haben, erleichtert
aufatmen.
Ratas russische Jagdflugzeuge)
und Il-2-Sturmgruppen von fünfzehn bis zwanzig Maschinen brausen, von
Nordosten kommend, auf die Verteidigungsstellungen der 170. ID zu. Rata-Jäger
greifen die deutschen Stellungen im Sturzflug an und feuern aus allen Waffen,
während die russischen Schlachtflugzeuge so tief über die deutschen
Stellungen hinweghuschen, daß sie mitunter von der Druckwelle ihrer eigenen
Bombenexplosionen hochgeschleudert werden.
Sie werfen Spreng- und
Splitterbomben, große und kleine. Dreißig Minuten dauert der Bomben- und
Bordwaffenangriff der sowjetischen Maschinen auf den „Flaschenhals" von
Schlüsselburg. Als die russischen Jagd- und Schlachtfliegerverbände dann
abdrehen und in nördlicher Richtung verschwinden, hinterlassen sie eine Trümmer-
und Kraterwüste.
Nach diesem Luftangriff liegt
die deutsche Verteidigungsfront in einer Art Agonie. Zuerst das furchtbare,
alles zertrümmernde Artilleriefeuer und jetzt der Bombenangriff. In den deustschen Stellungen herrschen Chaos, Verwirrung. Es gibt keinen Abschnitt im
deutschen Verteidigungssystem, der nicht einer Mondlandschaft gliche.
Zu diesem Zeitpunkt gibt
General Duchanow den Angriffsbefehl.
Die russischen Sturmregimenter
gehen vor. Dutzende roter und grüner Leuchtsignale steigen am jenseitigen
Newa-Ufer hoch.
Der Obergefreite Rupp starrt
hinter seinem MG 42 mit zusammengekniffenen Augen auf das Eis der Newa hinab.
Neben ihm liegt der Gefreite Doren.
„Mann, sieh dir das bloß
an", sagt dieser mit beklommener Stimme und tief beeindruckt von dem
Bild, das sich ihnen bietet.
Die Rotarmisten kommen in
dichten Angriffswellen über den Fluß, Hunderte, Tausende. Ohne Deckung nähern
sie sich lautlos den deutschen Stellungen.
„Die glauben bestimmt, wir
sind kaputt", wendet sich Doren an den
Kameraden.
E s sind die Regimenter der
sowjetischen 13. und 45. Schützendivision, die im Vertrauen auf die
vernichtende Feuerkraft der eigenen Artillerie und Schlachtflugzeuge
angreifen.
Rupp, den Finger am Abzug, das
MG auf Dauerfeuer eingestellt, macht unwillkürlich Zielübungen.
Die Hälfte des Flusses haben
die russischen Bataillone inzwischen hinter sich gebracht. Auf deutscher Seite
fällt kein Schuß.
„Noch 500 Meter", sagt
der Gefreite Doren. Rupp nickt bestätigend.
Er ist plötzlich derart nervös,
daß ihm der Schweiß ausbricht; obwohl es so kalt ist, daß der Atem vor dem
Mund gefriert.
Dann ist mit einemmal Feldwebel
Odenbach im MG-Stand. Er ist abgehetzt und quetscht sich zwischen Rupp und
Doren. Er schaut durch
das Glas.
Auch Odenbach, den so leicht
nichts beeindrucken kann, ist perplex. Abgesehen von der Tatsache, daß hier
mindestens zwei Regimenter angreifen, fasziniert ihn noch etwas anderes: Die
ersten russischen Angriffsreihen tragen keine Stahlhelme, sondern Tellermützen.
Odenbach kann dies durch sein scharfes Zeissglas deutlich erkennen.
Er setzt das Glas ab und reicht
es dem Obergefreiten Rupp.
„Schauen Sie mal durch",
fordert er diesen auf. „Das sind doch Matrosen, die da übers Eis stürmen.
Oder täusche ich mich?"
„Stimmt, Herr
Feldwebel!" bestätigt Rupp.
In der Tat, die ersten
Angriffsreihen der Russen bestehen aus Bataillonen von Rotbanner-Matrosen der
Baltischen Flotte. Sie sind eine Elite-Einheit der Roten Armee und haben
freiwillig die Spitze übernommen. Voraus gehen die Bataillonskommandeure mit
gezogenen Pistolen. Neben ihnen die Fahnenträger. Dahinter kommen die
Pioniere, die Sprengtrupps, Minenräumspezialisten und Flammenwerferkompanien.
Noch 500 Meter, 400,300. Die
Deutschen verhalten sich noch immer still. Kein MG tackert, kein Granatwerfer
ploppt.
Schon steigen die ersten „Urrä"-Schreie
auf, pflanzen sich durch die Reihen fort und schwellen zu einem gewaltigen
Chor an.
„Urrää - Urrää - Urrää!"
In dem felsenfesten Glauben,
der Widerstand der Deutschen sei durch den Feuerorkan der sowjetischen
Artillerie und Schlachtflieger zusammengebrochen, werden die russischen
Sturmregimenter von einer Euphorie erfaßt, die sie jede Vorsicht vergessen läßt.
Sie ahnen nicht, daß sie mitten ins Verderben rennen.
„Noch zweihundertfünfzig
Meter, Herr Feldwebel", mahnt der Obergefreite Rupp seinen Zugführer.
Odenbach nickt und schiebt eine
grüne Leuchtpatrone ein.
„Zweihundert Meter",
sagt neben ihm Rupp, den Zeigefinger am Abzugsbügel.
Da hebt Feldwebel Odenbach den
rechten Arm und knallt die grüne Leuchtrakete, das Signal für „Feuer
frei", aus dem Lauf.
Fast zur gleichen Zeit zischen
Hunderte von Leuchtzeichen in den Morgenhimmel, und schlagartig setzt das
rasende Tackern der Maschinengewehre, das Floppen der Granatwerfer und das
Rauschen und Fauchen der Artilleriegeschosse ein.
Die deutschen Waffen hämmern
in die Angriffsreihen der Rotbanner-Matrosen und mähen sie nieder. In Minuten
bilden sich auf dem Fluß wahre Berge von gefallenen Soldaten. Dennoch stürmen
die Nachfolgenden weiter, steigen über die Leichen hinweg,'bis auch sie, vom
Geschoßhagel erfaßt, verwundet oder tot zu Boden sinken.
Manchmal sieht es so aus, als würden
die Sturmregimenter in Panik geraten. Da und dort flitzen die Kompanien
auseinander oder ballen sich ängstlich zusammen, aber immer wieder gibt es
entschlossene Offiziere, Kommandeure, die rücksichtslos durchgreifen und die
Rotarmisten vorantreiben.
„Urrä Urrä!"
Sie rennen weiter, fanatisch
und gehorsam, bis auch sie der Tod erteilt.
Die Unterschätzung des Gegners
und die Überschätzung des eigenen Artilleriefeuers kosten die Sowjets an
diesem Morgen des 12. Januar 1943 Tausende von Toten und Verwundeten.
Ein kleines Häuflein deutscher
Landser, bestehend aus den Resten der Grenadierregimenter 391 und 401 und der
Aufklärungsabteilung 240 bei Gorodok, stoppt die rote Flut.
Die in der vergangenen Nacht
vom Gegner mit großer Kühnheit durchgeführten Minenräumungen sind umsonst
gewesen. Nicht eine Angriffswelle erreicht das deutsche Ufer. Nur ein paar
ganz verwegene Rotarmisten arbeiten sich bis zu den Drahthindernissen durch,
aber auch sie geraten ins Punktfeuer der deutschen Schützen und verbluten
zwischen durchgeschnittenen Drahtrollen und aus dem Schnee gebuddelten Minen.
Nachdem die dritte, die vierte
und auch die fünfte Angriffswelle im Räume Gorodok und Marino
zusammengeschossen ist, erlahmt die Kraft der sowjetischen Sturmregimenter
zusehends.
Da hilft es auch wenig, daß
der russische Battalionskommandeur, Major Psjol, mit letzter Energie das Blatt
zu wenden versucht und — die aussichtslose Lage sehr wohl erkennend - einem
seiner Ordonnanzoffiziere den Befehl gibt: „Telefonisten nach vorn. Wir
brauchen Artillerieunterstützung!" Nach Gefangenenaussagen
rekonstruierte Vorgänge.
Der junge Unterleutnant, einer
der letzten noch lebenden Offiziere des 333. Gardeschützenregiments, rennt in
den Kugelhagel der deutschen MG zurück, um einen Mann mit Tornisterfunkgerät
zu erreichen. Doch es gibt weit und breit kein solches Gerät. Man hatte
keines mitgenommen. Wozu auch? Seitens der russischen Führung war man der
festen Überzeugung, daß der Einbruch in die deutsche HKL gelingen würde.
Dann hätte die Artillerie immer noch Zeit genug gehabt, Telefonleitungen zu
den vorgeschobenen Beobachtern zu legen.
„Dann hol Pak heran",
befiehlt Major Psjol dem Unterleutnant, als dieser ihm von der
Ergebnislosigkeit seiner Bemühungen berichtet.
Der Unterleutnant rennt zum
zweiten Mal los. Aber die Sturmregimenter haben auch keine Pak mit.
Da packt den Major der Zorn. Er
schafft es mit Flüchen und Befehlen, an die siebzig Mann zusammenzubringen,
setzt sich an ihre Spitze und
greift wieder an.
Der Sturmversuch endet nach
zweihundert Metern im Geschoßhagel der Maschinengewehre der Aufklärungsabteilung
240 (AA 240) vor dem Krankenhaus von Gorodok.
Als der Major die
Aussichtslosigkeit seines Unternehmens erkennen muß und seine Männer tot
oder schwer verwundet zu Boden stürzen, jagt er sich eine Kugel durch den
Kopf.
Der einzige Überlebende dieses
Unternehmens, der junge Unterleutnant, selbst mehrfach verwundet, streckt die
Arme in die Höhe und torkelt auf die deutschen Linien zu. Völlig verstört
wird er von den Männern der AA 240 gefangengenommen.
Nachdem die Sturmdivisionen von
General Duchanows 67. Armee bei Gorodok und Marino keinen Fußbreit Boden
gewinnen konnten, setzt die sowjetische Führung ihre ganzen Hoffnungen auf
den Dubrowka-Abschnitt.
Im Zeitraum vom 20.7.1942 bis
15.9.1942 wurde mein Großonkel Otto Walter Friedrich dem Grenadier Regiment
399 unterstellt.
Vom 16.9.1942 bis 8.7.1943
wurde er wegen Gelbsucht ins Reservelazarett Bad Harzburg und
danach ins Reservelazarett Tapiau überstellt. Nach Genesung wurde er
der 1.Genesendenkompanie Grenadier Ersatz Battailon 47 überstellt.
Ab den 24.7.1943 kam mein Großonkel
wieder zurück zum Grenadier Regiment 399 vor Leningrad.
Seit dem 18.1.1944 ist mein
Großonkel verschollen.
Dubrowka, nur 10 km südlich
von Gorodok gelegen, wird zur Stunde von der 45. Gardeschützendivision des
Generalmajors Krasnow angegriffen.
Ihr gegenüber liegt das 399.
Grenadierregiment (GR 399) der 170. Infanteriedivision (170. ID). Es weist ein
Drittel der von den Russen eingesetzten Kampfstärke auf.
Im Dubrowka-Abschnitt liegen
die Dinge anders als bei Gorodok oder Marino. Dort trennt die Newa Russen und
Deutsche voneinander. Hier aber sind die Linien verzahnt, greifen ineinander
über, seit die Sowjets im November 1942 ostwärts der Newa einen kleinen Brückenkopf
bilden konnten.
„Totenecke" nennen die
Soldaten des GR 399 diesen Abschnitt. Und das zu Recht, denn dieses Stück
russischer Erde ist übersät mit Toten. Sie liegen zu Hunderten, ja zu
Tausenden herum. Niemand kann sie bestatten, und dort, wo man es dennoch
versuchte, wurden die Leichen durch das beiderseitige Artilleriefeuer wieder
ans Tageslicht befördert. Die Gegner liegen sich nur auf dreißig, vierzig
Meter gegenüber.
Angesichts dieser Lage blieb
dem Kommandeur des GR 399, Oberst Griesbach, keine andere Wahl, als seinen
Verteidigungsabschnitt besonders tief zu staffeln, Hunderte von engen Gräben
anzulegen, die MG-Stände und Kampfbunker zu verdrahten und zu verminen, das
ganze Stellungssystem in kleine, aber kampfstarke Stützpunkte aufzuteilen.
Zwischen den einzelnen
Widerstandsnestern haben die Regimentspioniere raffinierte Minenfallen
angelegt, und wehe dem Unkundigen, der in eine solche gerät. Auch gut
versteckte Flammenwerfer - elektrisch gezündet - bringen dem Angreifer Tod
und Verderben.
Dubrowka wurde in monatelanger
Winterarbeit zu einem „Teufelsgarten" Rommeischer Art
( Gemeint sind die Minenfelder vor El Alamein )
verwandelt, der die
Russen das Fürchten lehrte.
Dutzende Male versuchten die
Sowjets den Sperrriegel des GR 399 aufzubrechen. Sie kamen mit Stoßtrupps.
Bei Tag und auch bei Nacht. Immer wieder rannten sie verbissen an. Umsonst.
Sie fielen im Nahkampf, wurden von Minen zerrissen, endeten im Glutstrahl der
Flammenwerfer. Diese Gefallenen gaben dem Dubrowka-Abschnitt schließlich den
Namen „Totenecke".
Als die Sowjets mit Infanterie
nicht durchkamen, setzten sie Panzer ein. Die T 34 schafften es auch nicht.
Sie würden von der 7,5-cm-Pak abgeschossen. Und was diese nicht erledigte,
vollendeten die Nahkampftrupps des GR 399.
Noch jetzt liegen die ausgeglühten
Panzerwracks vor, in und auf den Gräben des GR 399. Die Grenadiere hatten sie
zu unüberwindbaren Kampfständen ausgebaut, und in den Wracks sitzen auch die
VB
(vorgeschobene Beobachter)
der Artillerie oder vorgeschobene Gefechtsstäbe.
Da man in die T 34 von außen,
also von oberhalb der Erde, nur schwer kommen kann, hatten die Pioniere
Stichgräben zu den Panzerwracks vorgetrieben und mit Schweißbrennern
Einstieglöcher in die Bodenwanne geschnitten. Die Rotarmisten, denen die T 34
selbstverständlich ein Dorn im Äuge waren, wußten nie, wann die
Panzerwracks besetzt waren. Dann und wann holten sie Pak heran und
veranstalteten ein wüstes Scheibenschießen auf die Panzer. Sie brachten auch
Treffer an, aber mittlerweile hatten die lästigen „Untermieter" längst
ihre stählerne Wohnung geräumt und waren in den tiefen Gräben verschwunden.
Neben den zahlreichen Minenfallen stellten die eigentlichen Minenfelder ein
Problem ganz besonderer Art dar. Im Laufe der Zeit hatten fünf verschiedene
Einheiten Minen verlegt. Die Skizzen hierfür existierten nicht mehr, so daß
weder Freund noch Feind wußten, wo Minen vergraben waren. Oberst Griesbach
hatte aus diesem Grund den gesamten Regimentsabschnitt zum „minenverseuchten
Gebiet" erklären lassen.
Das also ist das Gelände, in
dem Generalmajor Krasnows Gardeschützen angreifen sollen.
Eine halbe Stunde vor dem
Beginn der Offensive gibt der russische Divisionskommandeur seine HKL für die
eigene Artillerie frei. Die Infanterie räumt blitzschnell ihre Stellungen,
und als der letzte Mann in Sicherheit ist, gibt Krasnow den
„Feuerbefehl"!
Aber sein Gegenspieler, Oberst
Griesbach, zeigt sich der Lage gewachsen. Da der Regimentskommandeur des GR
399 mit einem massierten Artillerieeinsatz des Gegners rechnen mußte, hat er
entsprechende Vorkehrungen getroffen.
Es gibt für den X-Fall einen
Alarmplan. Dieser sieht vor, daß sich die vorderste Linie innerhalb weniger
Minuten in weiter zurückliegende und längst vorbereitete Ausweichstellungen
absetzt.
In vielen Probealarmen wurde
dieses Absetzen aus der vordersten HKL geübt. Jeder Grenadier weiß, wohin er
rennen muß, er kennt jede Grabenbiegung.
Generalmajor Krasnows Absicht,
die Deutschen mit einem furiosen Feuerschlag kalt zu erwischen, schlägt dank
der Vorsorge eines deutschen Regimentskommandeurs fehl.
Als an allen Frontabschnitten
im „Flaschenhals" von Schlüsselburg schlagartig das russische
Artilleriefeuer einsetzt (freilich mit anderthalbstündiger Verspätung, so daß
das GR 399 längst gewarnt ist), wird beim GR 399 der Alarm ausgelöst. Ohne
einen einzigen Mann zu verlieren, wird die vorderste HKL geräumt.
Die russische Artillerie
verschießt im Abschnitt Dubrowka an diesem Morgen des 12. Januar 1943
insgesamt 7 000 Granaten von mittlerem und schwerem Kaliber. In Feuerwalzen
wird das Gelände umgeackert, und schon nach wenigen Minuten ist nicht mehr zu
erkennen, wo einmal Deutsche und wo Russen gelegen haben.
Genau 45 Minuten dauert der
russische Feuerorkan, dann läßt Krasnow seine 45. Gardeschützendivison los.
Drei gutausgerüstete und
kampferfahrene Garderegimenter treten zum Sturm gegen die Stellungen des GR
399 an, eine wogende Menschenlawine, die Furcht und Schrecken verbreiten soll.

Die zerschossenen deutschen
Stellungen werden erreicht. Die Rotarmisten suchen den Nahkampf und finden
leere Gräben. Und dann wummern die ersten Explosionen: Minen! Die
Artilleriefeuerwalze hatte Hunderte von Minen in die Luft gejagt. Aber es sind
noch genug übriggeblieben, und die Gardisten rennen in den Tod. Ganze
Kompanien sterben, .ehe sie überhaupt den Feind zu sehen bekommen.
Die das Glück haben, auf keine
Mine zu treten, zögern jetzt. Aber neue Befehle treiben die russischen
Soldaten nach vorn. Über die zerfetzten Leiber stürmen sie weiter vor.
Den Grenadieren des GR 399 wird
die Kehle trocken, als sie diese Massen ankommen sehen. Doch sie behalten die
Nerven, warten, lauern in Gräben und Kampf ständen, den Finger am Abzug der
Waffe.
Einer der zahlreichen
vorgeschobenen Stützpunkte im Verteidigungsabschnitt des GR 399 - ein
sogenannter Wellenbrecher - ist
der Stützpunkt „Liesel". Er ist von 23 Mann und einem Unterführer
besetzt. Befehligt wird der kleine Haufen von Feldwebel Bockholt.
Stützpunkt „Liesel"
liegt 200 Meter hinter der vordersten und mittlerweile geräumten HKL. Er
besteht aus zwei Kampfständen, die durch mehrere Gräben miteinander
verbunden sind.
In einem der Kampfstände steht
Feldwebel Bockholt hinterm Sehschlitz und blickt angespannt vor zu B 4, das
ist eine jener raffiniert angelegten Minenfallen, ein Stückchen
„Teufelsgarten". Er besteht aus fünf strahlenförmig
auseinanderlaufenden Stichgräben, in der Mitte ein MG-Bunker, der zur
Rundumverteidigung eingerichtet ist. Die Lage von B 4 ist absichtlich so
exponiert gewählt worden, damit die Minenfalle vom Gegner nicht übersehen
werden kann.
Seitlich abgesetzt davon, in
einer Entfernung von etwa 80 Metern, liegt der Gefreite Fuchs mit einem MG 42.
Seine Aufgabe ist es, durch kurze Feuerstöße eine besetzte Stellung vorzutäuschen,
die Russen „anzulocken". Zu Feldwebel Bockholt hat Fuchs
Sichtverbindung. Erst auf Bockholts Zeichen darf der Gefreite das Feuer eröffnen.
Aber noch ist es nicht soweit.
Der stürmische Angriffsfluß ist etwas ins Stocken geraten, die russischen
Kompaniechefs haben offenbar Mühe, ihre Männer in der Trichterlandschaft
zusammenzuhalten.
Doch dann ist plötzlich eine
ganze Kompanie russischer Gardeschützen da. Voraus ein Offizier. Er hat den
deutschen Kampfstand ausgemacht, winkt jetzt seine Züge ein, brüllt Befehle.
Feldwebel Bockholt liegt mit
dem Glas hinter der Grabenwehr und läßt die Russen keine Sekunde aus den
Augen. Einige Trupps springen jetzt in die vordersten Gräben. Da gibt
Feldwebel Bockholt das Zeichen zur Feuereröffnung.
Fuchs läßt sein MG rattern,
streut mit kurzen Feuerstößen das Gelände um B 4 herum ab, wobei es weniger
darauf ankommt, daß er den Gegner trifft, als vielmehr darauf, Widerstand
vorzutäuschen.
Die Rotarmisten spritzen
auseinander, zwei Russen bringen ein MG in Stellung, feuern in den Kampf
stand, während ein Trupp Gardeschützen mit „Urrä" in einen
Stichgraben eindringt und sich mit Handgranaten einen Weg bahnt. Auch der
sowjetische Offizier ist plötzlich wieder da. Seine Kommandos übertönen den
Gefechtslärm, bringen Bewegung in die angreifenden Russen.
Es sind an die siebzig Mann,
die schießend in B 4 eindringen und zunächst offenbar gar nicht mitbekommen,
daß sie in einer verlassenen Stellung kämpfen.
„Zünden!" befiehlt da
Feldwebel Bockholt dem Pionierobergefreiten Schmidke, der mit einem Druck die
elektrische Zündanlage betätigt.
34 Schützenminen - von den
Pionieren 30 cm über der Grabensohle in den Schnee verlegt - gehen mit einer
gewaltigen Explosion in die Luft. Die Splitterwirkung ist verheerend. Die in B
4 eingedrungenen Rotarmisten haben keine Überlebenschance.
Minutenlang hängt eine riesige
Wolke aus Schneestaub über der Sprengstelle. Als sie sich schließlich verflüchtigt
und den Blick freigibt, gleicht der Kampfstand einer Mondlandschaft, in der
die Stille des Todes herrscht.
Während in diesem Abschnitt
die Gefahr für das GR 399 gebannt scheint, gelingt es den Russen - trotz des
minenverseuchten Gefechtsfeldes -, am linken Regimentsflügel mehrere Einbrüche
zu erzielen. Divisionsartillerie und schwere Granatwerfer nehmen den Gegner
unter Feuer. Und dann kommt der Befehl zum Gegenstoß. Er wird ausgelöst
durch das Leuchtzeichen: grün-weiß-grün.
Mit aufgepflanztem
Seitengewehr, mit dem Spaten in der Faust, werfen sich die Grenadiere des GR
399 den sowjetischen Gardeschützen General Krasnows entgegen. Es entbrennt
ein Kampf, wie ihn die Landser im Norden der Ostfront noch nie erlebt haben.
Wie eine Springflut in Tausende
von kleinen Rinnsalen ausläuft, so versickern die russischen Sturmbataillone
im tiefgestaffelten Verteidigungsfeld des Grenadierregiments; wobei die
Deutschen einen gewissen Vorteil haben, weil sie das Gelände kennen, während
die Rotarmisten verzweifelt bemüht sind, sich in dem Grabenlabyrinth
zurechtzufinden.
Zu spät erkennen die Russen,
daß sie in eine tödliche Falle gerannt sind. Wutentbrannt schießen, hauen
und stechen sie um sich. Sie sterben zu Hunderten im MG-Feuer der Deutschen,
fallen im gnadenlosen Nahkampf. Die Gräben füllen sich mit den Leibern der
Toten.
In weniger als fünfundzwanzig
Minuten wird beispielsweise das II. Bataillon Gardeschützenregiment 333 fast
völlig aufgerieben. Die 4. Kompanie dieses Bataillons besteht nur noch aus
siebenunddreißig Mann. Der Kompanieführer, Oberleutnant Konjukow, liegt mit
einem Brustschuß im Schnee. Schon vom Tod gezeichnet, rafft er sich auf und
versucht seine Gardeschützen anzuspornen.
Es ist umsonst. Die
Rotarmisten, von Entsetzen und Grauen geschüttelt, mit Maschinenpistolenfeuer
und Handgranatenwürfen eingedeckt, weichen zurück.
Ein ganzes Bataillon gerät in
Verwirrung und Panikstimmung. Die Überlebenden laufen zurück, jagen durch
die von der Artillerie zertrommelten Gräben.
Weit kommen sie allerdings
nicht. Hauptmann Sipjadom, der Bataillonskommandeur, stellt sich ihnen in den
Weg.
Doch zu diesem Zeitpunkt
starten die deutschen Grenadiere aus der Tiefe des Verteidigungsraumes heraus
einen Gegenstoß.
Es sind nicht viele, aber es
handelt sich um erfahrene Grabenkämpfer. Mit der blanken Waffe stürmten sie
heran. In erbitterten Nahkämpfen drängten sie die Russen noch ein weiteres
Stück in Richtung Newa-Ufer zurück.
Über eine Stunde lang müssen
sich die Gardeschützen, die sich in drei Kampfständen festgesetzt haben,
verzweifelt und unter großen Verlusten der wütend vorgetragenen Angriffe der
Deutschen erwehren.
Als sich die deutschen
Grenadiere schließlich zurückziehen, zählt Sipjadoms Bataillon noch ganze
sechzig Mann.
Trotz der erlittenen Schlappe
und der hohen Verluste gibt der sowjetische Hauptmann den Kampf noch nicht
auf. In drei Ausfällen, die dem Zweck dienen, wenigstens einen Teil des
verlorengegangenen Geländes zurückzugewinnen, versucht Sipjadom das Blatt
noch zu wenden. Aber die Deutschen sind auf der Hut. Im Feuerschlag mehrerer
schwerer Granatwerfer bricht auch dieser Angriff der Rotarmisten zusammen.
Nach dieser Gewaltanstrengung
ist es mit der Nervenkraft der Gardeschützen vorbei. In den mit Leichen angefüllten
deutschen Gräben richten sich Sipjadoms Männer zur Verteidigung ein.
Ebenso glücklos wie das
Bataillon Sipjadom
(Rekonstruktion nach sowjetischen Dokumentationen)
haben
auch die beiden anderen Bataillone des 333. Schützenregiments gekämpft. Nach
zwei Stunden muß der Regimentskommandeur, Oberst Babschenko, General Krasnow
in einer kurzen Funkmeldung die Niederlage eingestehen.
Da Krasnows ungezügeltes
Temperament und dessen sprichwörtliche Unduldsamkeit in der ganzen Division
bekannt sind, rechnet der Oberst mit dem Schlimmsten. Um so erstaunter ist
Babschenko, als er statt der Rüge einen Funkspruch folgenden Inhalts erhält:
- Kommandeur 45. Garde Schützendivision
spricht Gardeschützenregiment 333 volle Anerkennung aus. Greifen Sie weiter
an, Babschenko! -
Dieser Funkspruch verschlägt
dem Obersten die Sprache. Was bedeutet das? Krasnow honoriert eine Niederlage
mit Worten der Anerkennung! Das hatte es noch nie gegeben.
Noch mehr Verwirrung 20 Minuten
später. Babschenkos Adjutant kommt mit allen Anzeichen tiefster Bestürzung
an und berichtet dem Obersten, daß man eben einen Funkspruch der
Armee-Division mitgehört habe, in dem davon die Rede war, daß mehrere
Kommandeure und Kornpanieführer der 45. Division wegen „militärischer Unfähigkeit"
ihrer Kommandos enthoben wurden.
Kommandoentzug und Standgericht
auf der einen Seite, Lob und Anerkennung aber für das 333. Schützenregiment.
Babschenko kann sich diese Widersprüchlichkeit nicht erklären. Er wird das
dumpfe Gefühl nicht mehr los, als verberge sich hinter dem Lob des Generals
die Drohung: Ich gebe dir noch einmal eine Chance. Nütze sie!
Rekonstruktion nach
sowjetischen Dokumentationen
Babschenko, 38 Jahre alt, ist
der Typ des jungen sowjetischen Karriereoffiziers, der dank persönlicher
Tapferkeit und rücksichtsloser Einsatzbereitschaft rasch die militärische
Erfolgsleiter hochgeklettert ist. Er glaubt sich in Gefahr, reagiert ganz
typisch und funkt an General
Krasnow:
- Kommandeur 333. Gardeschützenregiment
tief beschämt über ausgesprochenes Lob. Kommandeur und Regiment werden sich
des in sie gesetzten Vertrauens würdig erweisen, gez. Babschenko. -
Dieser Funkspruch wurde vorn
deutschen Abhördienst Wort für Wort mitgehört und aktenkundig gemacht.
Die genauen Zusammenhänge
konnten freilich erst später durch Gefangenenaussagen und
Tagebucheintragungen rekonstruiert werden. Die dabei gemachten Recherchen
gaben einen Einblick in die völlig andersgeartete Mentalität des russischen
Gegners. Das Verhalten dieses sowjetischen Regimentskommandeurs war
symptomatisch für den Geist des sowjetischen Offizierskorps, der den
Deutschen nicht selten unlösbare Rätsel aufgab.
Obgleich Oberst Babschenko sich
darüber im klaren ist, daß sein Regiment bestenfalls noch aus ganzen drei
einsatzfähigen Kompanien besteht, und diese moralisch schwer angeknackst
sind, setzt er sich über alle Vernunft hinweg und befiehlt die Fortsetzung
des Angriffs. Ehrgeizig, rücksichtslos, gewillt, das Unmögliche zu
erzwingen.
Ganz überraschend und ohne
vorherige Anmeldung kreuzt der Oberst mit seinem Adjutanten beim Bataillon des
Hauptmanns Sipjadom auf. Dieser, durch einen Funkspruch gerade noch
rechtzeitig verständigt, ahnt instinktiv, daß es zu einer harten
Auseinandersetzung kommen
wird.
Sipjadom hatte eben die
verstreuten Reste seines schwer angeschlagenen Bataillons einigermaßen
geordnet, als der Oberst in Sipjadoms Gefechtsstand, einem ehemaligen
deutschen Kampfstand, erscheint.
Babschenko ist verschwitzt, mit
Blut besudelt, sein Gesichtsausdruck finster, beinahe böse. Ehe Sipjadom eine
Meldung erstatten kann, knurrt ihn der Oberst an: „Ich befehle: Der Angriff
wird fortgeführt!"
Hauptmann Sipjadom sieht ihn
fassungslos an. Aber der Oberst scheint keine Erläuterung für nötig zu
halten und wendet, sich ab.
Sipjadom geht aus dem Bunker
und trommelt die Reste seines Bataillon zusammen. Das sind vierundsiebzig
Gardeschützen, vier Unteroffiziere und zwei Unterleutnants. Alle anderen
Offiziere des Bataillons sind gefallen oder schwer verwundet.
Als er in den Bunker zurückkommt,
um Oberst Babschenko Vollzugsmeldung zu erstatten, hat dieser über Funk
Verbindung zur Division aufgenommen. Der Oberst verlangt Feuerunterstützung
der Artillerie. Die Division läßt den Oberst wissen, daß zur Zeit keine
Artillerie zur Verfügung stehe, da diese anderweitig schwerpunktmäßig
eingesetzt sei. Er könne aber vier schwere Granatwerfer bekommen. Der Oberst
fragt an, wann die Granatwerfer zur Verfügung stünden. Die Antwort lautet:
Frühestens in einer halben
Stunde. Daraufhin beendet Babschenko brüskiert das Gespräch und wendet sich
an Hauptmann Sipjadom. „Das dauert mir zu lange. Wir greifen ohne die
Granatwerfer an." Umsonst versucht der Hauptmann, den Oberst zu überreden,
diese dreißig Minuten noch abzuwarten, denn man könne unmöglich ohne
schwere Waffen angreifen. Babschenko beharrt jedoch auf seinem Entschluß.
Der Angriff endet, wie
Hauptmann Sipjadom es vorausgeahnt hat, in einem Fiasko. Nach dreiviertelstündigem
Kampf muß das Gefecht abgebrochen werden. Alle Versuche Sipjadoms,, seine
Soldaten voranzutreiben, scheitern am erbitterten Widerstand der deutschen
Grenadiere und an der totalen Erschöpfung der Gardeschützen. Mit Mühe und
Not rettet der Hauptmann den Rest seines Bataillons, das sind noch
einundzwanzig Mann. Bei einem Feuerüberfall deutscher Granatwerfer kommen
noch weitere vier Soldaten ums Leben, und Hauptmann Sipjadom wird durch
Granatsplitter im Gesicht verletzt.
Siebzig Minuten nach dem mißlungenen
Angriff meldet sich Sipjadom bei Babschenko zurück, der, fast ungedeckt auf
einem Granattrichterrand sitzend, mit dem Glas den Angriff verfolgt hat.
Sipjadom grüßt und läßt die MPi in den hartgefrorenen Schnee gleiten.
Der Oberst streift ihn mit
einem sonderbaren Blick, dann läßt er sich unvermittelt in den
Granattrichter gleiten, winkt dem Hauptmann zu und bedeutet diesem, er möge
ihm folgen. „Wie viele Männer haben Sie noch, Genosse Hauptmann?"
„Einundzwanzig! Die beiden Unterleutnants sind tot." „Holen Sie alle
her und was Sie sonst noch auf treiben können!" befiehlt Babschenko.
„Ich wiederhole den Angriff und führe ihn selber."
„Sie haben keine Chance, Genösse
Oberst", sagt Sipjadom sachlich und ganz ruhig. „So? Meinen Sie
wirklich?"
„Jawohl! Das ist meine feste
Überzeugung", sagt der Hauptmann. „Aber nicht die meine",
erwidert Babschenko. „Und nun führen Sie meinen Befehl aus!"
Sipjadom gibt es auf.
Achselzuckend entfernt er sich. Bei den Gardeschützen stößt er auf Gleichgültigkeit,
Sie hören ihm gar nicht zu. Sie sind der Vernichtung entgangen, und das ist
im Moment das Wichtigste für sie. Daß sie noch einmal dieselbe Hölle
durchmachen sollen, begreifen sie im Augenblick gar nicht.
Inzwischen hat Hauptmann
Sipjadom noch weitere sieben Soldaten gefunden, so daß dem Oberst nun
achtundzwanzig Mann zur Verfügung stehen. Auch die Granatwerfer sind
mittlerweile eingetroffen. Sie werden von Sipjadom eingewiesen.
Er findet den Kommandeur auf
demselben Granattrichterrand. „Es ist alles für den Angriff bereit, Genosse
Oberst", erstattet Sipjadom Meldung und wirft sich neben ihm zu Boden,
weil er nicht die geringste Lust verspürt, den deutschen Scharfschützen als
Zielscheibe zu dienen.
Babschenko, den Blick geradeaus
gerichtet, nickt und schweigt. Er hat das Doppelglas an den Augen und späht
zu den deutschen Linien hin.
„Danke!"
In diesem Augenblick kracht ein
Gewehrschuß. Das Projektil saust so nahe an Babschenkos Kopf vorbei, daß
dieser zusammenzuckt. Trotzdem bleibt er auf dem Kraterrand sitzen.
Da kracht es zum zweitenmal.
Die Gewehrkugel schlägt nur wenige Zentimeter vor dem Obersten in den Schnee,
und zieht eine Furche.
Sekunden später der dritte
Schuß.
Die Kugel des deutschen
Scharfschützen trifft den russischen Offizier mitten in den Kopf. Babschenko
sinkt, ohne einen Laut von sich zu geben, vornüber.
Hauptmann Sipjadom, der sich
schon beim ersten Schuß zu Boden geworfen hatte, greift zu und zieht ihn in
den Granattrichter. Wenige Sekunden später stirbt der Oberst.
Er hat den Tod gesucht, geht es
Sipjadom durch den Kopf. Dann befiehlt er zwei Rotarmisten, die Leiche des
Kommandeurs in den Bunker zu schaffen.
Mittlerweile ist es der
Funkstelle gelungen, eine Verbindung zur 45. Schützendivision herzustellen.
Sipjadom kann somit den Tod des Regimentskommandeurs an die Division
durchgeben. Die Funksprechverbindung ist zwar nicht ganz einwandfrei, aber
Hauptmann Sipjadom kann sich dennoch einigermaßen mit der Gegenstelle verständigen.
Am anderen Ende ist der Politkommissar Proskatow. Er hört sich die Meldung
an, dann sagt er:
„Auf Befehl der Division sind
vorerst alle Angriffe im Raum Gorodok einzustellen. Das Regiment übernehmen
Sie inzwischen. Um 17 Uhr finden Sie sich zur Lagebesprechung ein. Ende."
Bei kritischer Betrachtung der
allgemeinen Lage sah es fast so aus, als wäre die sowjetische Offensive im
„Flaschenhals" ein Schlag ins Wasser gewesen, denn nirgends haben die
Russen ihre Angriffsziele erreichen können - weder bei Gorodok noch bei
Dubrowka und der Schlüsselburger Front selbst.
Doch trotz der ungeheuren
Blutopfer, die von den sowjetischen Sturmdivisionen gebracht wurden, behielt
der Oberkommandierende der sowjetischen Heeresgruppe Wolchow einen klaren
Kopf.
Noch war nicht aller Tage
Abend, und noch stand die gewaltige Schlacht nicht im Zenit. So fehlten
beispielsweise noch die Meldungen über die Operationen der 2. sowjetischen
Stoßarmee.
Diese war mit sieben Schützendivisionen
und einer Panzerbrigade von Osten her gegen den deutschen
„Flaschenhals" vor Schlüsselburg angetreten. Auf einer Breite von 13
Kilometern. Verteidigt wurde dieser Frontabschnitt von einer einzigen
deutschen Infanteriedivision, der 227. ID. Diese hatte lediglich zusätzlich
einige schwache Alarmeinheiten unterstellt bekommen.

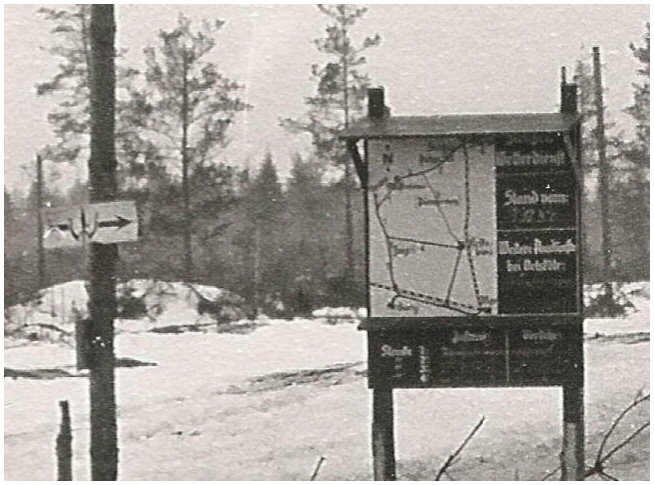
Der russische
Oberkommandierende hatte somit keinen Grund, die Nerven zu verlieren, zumal
seit zwei Stunden auch im Raum südlich von Schlüsselburg die Offensive
angelaufen war. Hier griff die 86. sowjetische Schützendivision an, eine
Elite-Einheit, die aller Voraussicht nach den Übergang über die Newa
schaffen würde.
Beängstigend für den
Oberbefehlshaber der Wolchow-Front war lediglich die Tatsache, daß die
Deutschen sich mit einer unglaublichen Zähigkeit der Angriffe erwehrten,
obwohl sie durch das ständige stundenlange Trommelfeuer hätten niedergekämpft
sein müssen.
„Besorgniserregende
Entwicklung", hieß es im Hauptquartier der 18. deutschen Armee. Bei
Generaloberst Lindemann herrschte höchste Alarmstufe. Die Telefonapparate
rasselten ununterbrochen, die Funker klebten auf ihren Stühlen, jagten Spruch
für Spruch in den Äther, Melder kamen und gingen, Kuriere hetzten zu den Stäben.
„Nie zuvor hatten wir so
stark das verdammt unangenehme Gefühl, auf einem Pulverfaß zu sitzen, an das
schon die Lunte gelegt worden ist", berichtet Oberleutnant Faßnacht,
einer von Lindemanns Ordonnanzoffizieren, über jene kritischen Stunden.
Der Generaloberst selbst ließ
sich nicht aus der Fassung bringen. Lindemann betrachtete die Lage, in der
sich seine Armee befand, ohne Illusionen, aber er wurde von der allgemeinen
Hektik nicht angesteckt.
Er wartete ab. Ruhig nahm er
die eintreffenden Hiobsbotschaften entgegen, während sein Stabschef die
Meldungen auf die Lagekarte übertrug. Den Oberbefehlshaber interessierten zur
Stunde nur die Fragen: Wo bilden sich feindliche Angriff s Schwerpunkte? Wo
wird der Gegner versuchen, die deutsche HKL zu durchstoßen, und wo führt er
seine Ablenkungsmanöver durch? Erst, wenn er die Pläne des Gegners
durchschaute, konnte er als der Armeeführer seine Entschlüsse fassen.
Eng verbunden mit der Frage
nach der feindlichen Schwerpunktbildung war die des Einsatzes der
Armee-Eingreifreserve. Und da sah es bei der 18. Armee böse aus. Eine einzige
Infanteriedivision stand Generaloberst Lindemann zur Verfügung, die 96. ID.
Es war eine Rußland erfahrene, kampferprobte Division. Sie war auch sofort
greifbar, allerdings nur mit fünf Bataillonen. Der Rest stand längst als
„Feuerwehr" an anderen Brennpunkten der bedrohten Nordfront. Gewiß,
Lindemann konnte außerdem noch auf eine Flakabteilung vom Flakregiment 36
(8,8-cm-Geschütze), auf eine Artillerieabteilung mit 15-cm-Haubitzen und auf
vier „Tiger" nebst acht Panzern IV zurückgreifen. Diese Streitmacht
mochte zwar auf den ersten Blick ganz beachtlich sein, die Perspektive
verschob sich jedoch sofort, wenn man bedachte, daß mit der Reserve eine
maximale Frontlänge von 36 km abgesichert werden sollte.
Mit einer Hilfeleistung der
Nachbararmeen konnte ebenfalls nicht gerechnet werden, denn dort sah es nicht
anders aus.
Bei Rschew, Welikije Luki und
Demjansk kämpften derzeit ganze Armeen um Sein oder Nichtsein. Die Fronten
waren überall überdehnt, und die Sowjets griffen mit überlegenen
Infanterie- und Panzerkräften an. Sie witterten Morgenluft und warteten nur
darauf, dem deutschen Ostheer die kriegsentscheidende Niederlage beibringen zu
können.
In der kritischsten Lage aber
befand sich zweifellos die 18. Armee, denn ihr drohte, wenn der Russe seine
Operationsziele erreichte, die totale
Einkesselung.
Kein Wunder also, wenn bei der
18. Armee das Gespenst von Stalingrad umging. Alle Orte, alle Stellungen und
jedes Waldstück waren zum „festen Platz" erklärt worden, und das war
erfahrungsgemäß ein böses Omen. Diese rigorose Maßnahme drückte nur die
Ohnmacht der Führung aus.
Der verzweifelte Kampf der 6.
Armee in Stalingrad saß Offizieren und Landsern sozusagen in den Knochen,
obwohl niemand davon redete. Aber in demselben Maße, wie die Furcht vor einer
Einkesselung bei den Truppen stieg, wuchs auch der Widerstandswille, jene unfaßbare
Kraft des Glaubens an die eigene Stärke, die schon so oft den Ausschlag
gegeben hatte.
Es ist am Mittag des 12. Januar
1943, als die Schlacht im „Flaschenhals" von Schlüsselburg ihren
absoluten Höhepunkt erreicht.
Die ersten sowjetischen Einbrüche
werden gemeldet. Zunächst können sie abgeriegelt werden. Aber die ungeheuren
Massen der russischen Infanterie stürmen unentwegt weiter - und werden zurückgeschlagen.
Tausende von Rotarmisten liegen tot auf dem Eis der Newa, vor und in der
deutschen HKL.
Nervosität breitet sich im
Hauptquartier des Oberkommandierenden der „Wolchow-Front" aus. Man kann
es einfach nicht fassen, daß die Gardeschützenregimenter nirgendwo den
entscheidenden Durchbruch
erzwingen können.
Die Meldungen, die im
Hauptquartier des sowjetischen Oberkommandierenden eintreffen, sind
niederschmetternd. „86. russische Schützendivision: Angriffsziel nicht
erreicht", heißt es in einem Funkspruch.
Gerade in diese Division hat
die russische Führung große Hoffnungen gesetzt. Nun aber zeigt es sich, daß
ausgerechnet der Elitekampfverband glücklos gekämpft hat. Er schaffte an
keiner Stelle den Übergang über die Newa. Es waren die deutschen Grenadiere
des I. Bataillons GR 401 (170. ID) und Teile der 227. ID, die hier den in
Massen angreifenden Russen eine fürchterliche Niederlage beibrachten.
Bedienungen deutscher
Maschinengewehre, leichter Feldgeschütze und Granatwerfer verschossen ihre
letzte Munition, kämpften zumeist sogar in offener Feuerstellung und zwangen
den Gegner nieder.
General Duchanow, der
Befehlshaber der 67. russischen Armee, sah sich deshalb gezwungen, auch in
seinem Abschnitt die Angriffe vorübergehend einzustellen.

Nicht anders ergeht es der mächtigen
2. sowjetischen Stoßarmee, welche die Ostseite des „Flaschenhalses"
berennt. Nach fünfstündigem Kampf hat sich auch ihr Angriff festgefahren.
Bei der deutschen 18. Armee
atmet man auf. Die Front der deutschen Grenadiere hat im Angriff s Schwerpunkt
bei Gorodok und Marino standgehalten, die sowjetische Angriffswalze vermochte
die Entscheidung nicht im ersten Ansturm herbeizuführen. Das ist für die 18.
Armee ein glänzender Abwehrerfolg, denn die Erfahrung hat gezeigt, was dem
Russen nicht auf Anhieb gelingt, erreicht er entweder gar nicht mehr oder nur
unter Anspannung seiner ganzen Kraft. Das heißt, die Sowjets sind gezwungen,
ihre Kräfte neu zu formieren, umzugruppieren, schwere Waffen heranzuschaffen.
Dazu benötigen sie Zeit, die den deutschen Verteidigern zugute kommt.
Gerade als die Schlacht für
eine Weile den Atem anhält, Generaloberst Lindemann sich berechtigte
Hoffnungen macht, das Ärgste überstanden scheint, da passiert das verhängnisvolle
Unglück.
12.45 Uhr. Marino, an der
Nahtstelle zwischen der Aufklärungsabteilung 240 und dem II. Bataillon
Grenadierregiment 401.
Das Gelände in diesem
Kampfabschnitt gleicht einem Sturzacker, der von Granaten aufgewühlt und
umgepflügt worden ist.
Das Steilufer der Newa ist
durch das Trommelfeuer der russischen Artillerie und der schweren Granatwerfer
gezackt wie ein Gebirgskamm. Unvorstellbar, daß hier noch ein Mensch leben
und kämpfen kann. Und doch sind es die Männer der Aufklärungsabteilung 240
(AA 240), die trotz wiedereinsetzenden Artilleriefeuers verbissen ihre
Stellungen halten und die starken russischen Stoßtrupps, die sich tollkühn
an das Newa-Ufer heranschieben, unter Beschuß nehmen.
Hauptmann Irle, der Kommandeur
der AA 240, leitet den Abwehrkampf in der vordersten Linie. Im Feuer der
russischen Artillerie springt er von Kompanie zu Kompanie, macht seinen Männern
Mut, sieht überall nach dem Rechten. Er weiß, wie wichtig es ist, ein
Beispiel zu geben. Die überbeanspruchten Männer dürfen nicht das Gefühl
haben, auf verlassenem Posten zu stehen.
„Nicht schlappmachen, Jungs.
Denen geht bald die Luft aus!" tröstet er.
Dankbare Blicke. Betont forsche
Redensarten, mit denen die Verzweiflung überspielt wird. Weiter! An drei
Granattrichtern vorbei, dann in einen Graben hinein, wo eine vier Mann starke
Gruppe mit einem MG liegt. Zehn Meter davon entfernt die Fragmente eines
Bunkers.
Als der Gruppenführer, ein
Unteroffizier, den Abteilungskommandeur erkennt, springt er vom MG weg und
will Meldung erstatten. Da dröhnen plötzlich Abschüsse auf. Einschläge von
„Stalinorgeln", Artilleriefeuer!
Die vier Männer der Gruppe
werfen sich in den Schnee.
Hauptmann Irle brüllt, winkt
ihnen zu: „Los, rüber zum Bunker!"
Der Bunker liegt im toten Schußwinkel.
Aber sie wollen nicht, schreien ihm etwas zu, was er in dem schrecklichen Getöse
nicht verstehen kann. Durch eine Wand aus Schnee und hochgewirbeltem Dreck läuft
der Hauptmann allein zurück. Ganz nahe vier donnernde Einschläge. Mit einem
Hechtsprung erreicht Irle die Deckung. Und dann verschlägt es ihm den Atem.
Er befindet sich in einem mit
Leichen gefüllten Kampf stand. Auf einem Lager aus Steppengras liegen etwa
elf Mann. Manche sind schrecklich zugerichtet. Einem fehlen beide Beine, einem
anderen hat es den rechten Arm abgerissen. Die Toten liegen in gefrorenen
Blutlachen, und die Körper sind in der Kälte erstarrt.
Jetzt ist Irle auch klar, warum
die vier Männer sich geweigert hatten, im Bunker Deckung zu suchen. Der
schaurige Anblick der Toten ließ sie ihr eigenes Schicksal zu deutlich
voraussehen.
Nach Beendigung des Feuerüberfalls
kriecht der Hauptmann wieder ins Freie. Wie aus Gräbern auferstanden, steigen
stumm, in ihren dreckiggrauen Tarnanzügen, die vier Soldaten und ihr
Unteroffizier aus den Granattrichtern und begeben sich vor zum MG-Stand.
Auf dem Weg zur 2. Kompanie
begegnet der Hauptmann einer Schlittenkolonne, die Munition nach vorn bringen
wollte. Sie geriet unvermittelt in das Feuer mehrerer „Stalinorgeln".
Von den sieben Männern haben zwei den Feuerschlag überlebt, die anderen,
dunkle Bündel im Schnee, sind tot. Die Trümmer des Schlittens liegen
verstreut im Schnee.
Bevor der Hauptmann mit den
beiden Landsern sprechen kann, hört er plötzlich vorn im Abschnitt der 2.
Kompanie heftiges MG-Feuer, Gewehrgeknatter, Abschüsse von Pak. Irle rennt
schon los und trifft auf einen Kompaniemelder, der ihn auf dem kürzesten Weg
zum Kompaniegefechtsstand bringt.
Nachdem der Kompanieführer
bereits in der ersten Stunde des Angriffs gefallen ist, wird die Kompanie
jetzt von einem Feldwebel geführt, der von einem einigermaßen
heilgebliebenen MG-Stand ausser liegt ganz vorn am Steilufer - den
Abwehrkampf der „Zwoten" leitet.
Auf dem Eis der Newa, etwa 150
Meter von den deutschen Stellungen entfernt, kann der Hauptmann an die vierzig
Russen erkennen. Sie haben zwei Maschinengewehre in Stellung gebracht, mit
denen sie den deutschen MG-Stand unter Beschuß nehmen. Dahinter, mitten auf
der freien Fläche, ist eine 7,62-cm-Pak der Sowjets aufgefahren und eröffnet
nun ebenfalls das Feuer.
„Ein starker russischer Stoßtrupp",
orientiert ihn der Feldwebel. „Die haben ja Mumm", knurrt Hauptmann
Irle.
„Sie kamen aufrecht gehend übers
Eis", sagt der Feldwebel und fügt erklärend hinzu: „Wir haben sie bis
auf zweihundert Meter herankommen lassen und dann mit diesem MG und dem
rechten Flanken-MG unter Feuer genommen. Jetzt liegen sie genau zwischen
unseren beiden Gewehren und können nicht mehr weiter." „Die Pak gefällt
mir aber gar nicht", sagt der Hauptmann. „Mir auch nicht", bestätigt
der Feldwebel. „Aber an die kommen wir nicht ran. Ist zu weit entfernt. Außerdem
haben wir keine Stahlmantelgeschosse mehr, Herr Hauptmann."
„Aber die Stellung muß
gehalten werden", murmelt Irle.
Minuten später bricht wieder
die Hölle los. Die Russen belegen das östliche Newa-Ufer mit schwerer
Artillerie und Granatwerfern, knallen mit Pak und Panzern, die sich rumpelnd
und kettenrasselnd über das holprige Eis heranschieben, auf die erkannten
Stellungen der AA 240 zu.
Zwanzig Minuten dauert der
massierte Feuerschlag, wobei Irles Männer den Kopf nicht aus der Deckung
kriegen. Und dann wimmelt der zugefrorene Fluß erneut von angreifenden
Rotarmisten. Es ist die sechste Welle, die mit „Urrä" anrennt. In der
zweiten Linie schleppen sie Sturmleitern mit.
„An die Gewehre! Feuer
frei!"
Auf der ganzen Linie bis hinüber
zum II. Bataillon Grenadierregiment 401 tackern nun die deutschen
Maschinengewehre, krachen die Karabiner. Der Tod fährt in die russische
Angriffsphalanx, mäht Reihe um Reihe nieder. Berge von Leichen türmen sich
auf dem Eis.
Eine ganze Stunde lang stürmen
die Rotarmisten, verteidigen Hauptmann Irles Männer ihre exponierte
Ostuferstellung. Plötzlich fällt dem Hauptmann auf: Beim II./GR 401 wird der
Gefechtslärm russischerseits immer stärker, während das Abwehrfeuer der
401er erschreckend schwächer wird.
„Menschenskind, ich glaube,
dort drüben bahnt sich eine Schweinerei an", mutmaßt der Kommandeur der
AA 240 und schaut den Feldwebel an.
Dieser nickt und meint: „Es
gibt hier eine Stelle, Herr Hauptmann, wo man den linken Flügel des II.
Bataillons sehr gut einsehen kann."
„Los, zeigen Sie mir die
Stelle!" befiehlt Hauptmann Irle.
Beide rennen mit eingezogenen Köpfen
und pfeifenden Lungen zirka 200 Meter nordostwärts, wo ein vorspringender
Knick im Steilufer gute Sicht zum II./GR 401 bietet,
Hauptmann Irle nimmt das Glas
an die Augen und späht hinüber.
Was er sieht, jagt ihm einen mächtigen
Schrecken ein.
Am linken Flügel des II./GR
401, also direkt an der Nahtstelle zur AA 240, haben die Russen in Kompaniestärke
das Steilufer erreicht, Leitern angelegt. Die ersten zwanzig, dreißig Mann,
deutlich im Doppelglas des Hauptmanns zu erkennen, klettern daran hoch. Sie
treffen offensichtlich auf keinen Widerstand. Die 401er wehren sich weder mit
Handgranaten noch mit Maschinenpistolen, und das kann nur bedeuten, daß die
Uferverteidigung völlig zusammengebrochen ist.
Der erfahrene Kommandeur der AA
240 ist sich sofort im klaren darüber, daß höchste Gefahr im Verzug ist. Er
selbst kann den 401ern nicht zu Hilfe kommen, weil die eigenen Kräfte kaum
ausreichen, die unter starkem Druck stehenden Verteidigungsstellungen der AA
zu halten. Aber man könnte durch flankierendes Feuer dem Nachbarn Entlastung
bringen. Dies ist allerdings nur vom Abschnitt der 1. Kompanie aus möglich.
Noch wichtiger ist es jedoch, Verbindung zum II./GR 401 aufzunehmen. Es
besteht dorthin eine Querschaltung. Die Frage ist nur, ob diese noch intakt
ist.


Wie vom Teufel gejagt, rennt
der Hauptmann zu seinem Gefechtsstand zurück und kommt dort völlig
ausgepumpt an.
Der Hauptmann gönnt sich nur
einige Sekunden Ruhe, dann fragt er den Adjutanten, ob noch Telefonverbindung
zu den 401ern bestünde.
„Vor einer halben Stunde
klappte es noch."
„Dann stellen Sie sofort eine
Verbindung her", befiehlt Irle und zündet sich zur Beruhigung eine
Zigarette an.
Der Abteilungsnachrichtenzug
ist in zwei Bunkern unmittelbar neben dem Gefechtsstand untergebracht.
„Sofort eine Verbindung zum
II./GR 401", fordert der Adjutant, als er den Nachrichtenbunker betritt.
„Zu Befehl, Verbindung zu II.
Bataillon GR 401", wiederholt der Fernsprecher, ein Obergefreiter,
mechanisch und stöpselt durch, beginnt die
Kurbel zu drehen.
Es dauerte eine ganze Weile,
aber dann brüllt der Obergefreite dem Leutnant zu: „Verbindung ist da
..." Der Adjutant will den Hörer ergreifen, aber Hauptmann Irle steht
schon neben dem Telefonisten und reißt ihm den Hörer aus der Hand.
„Hier Aufklärungsabteilung
240, Hauptmann Irle. - Hallo - wer spricht? Ich kann Sie nicht
verstehen..."
Irle stößt einen Fluch aus.
„Verdammt noch mal, da ist kaum was zu hören ... Hallo, hallo! Ja, endlich.
Können Sie mich verstehen?" Er hat wieder Verbindung. „Holen Sie Ihren
Kommandeur an den Apparat!"
Doch da wird die
Telefonverbindung zum II. Bataillon erneut unterbrochen.
So geht das einige Minuten lang
hin und her. Manchmal kann der Hauptmann Wortfetzen aufnehmen, merkwürdige
Geräusche, dann wieder herrscht Totenstille in der Leitung.
Aber Irle gibt nicht auf. Plötzlich
dringt aus dem Hörer die klare Stimme eines Mannes: „Hier Gefechtsstand II.
Bataillon GR 401..."
„Mit wem spreche ich?"
unterbricht Hauptmann Irle den anderen.
„Hier spricht Unteroffizier
Uhlmann", tönt es aus dem Hörer.
„Sprechen Sie!" fordert
der Hauptmann den Unteroffizier auf. „Was ist los bei euch? Geben Sie mir
Ihren Kommandeur, Uhlmann. Es ist dringend..."
Unteroffizier Uhlmann antwortet
zwar, aber Irle kann die Worte nicht verstehen, weil sie von Gefechtsgeräuschen
übertönt werden. Die Stimme bricht ab, das Krachen von explodierenden
Handgranaten und Maschinenpistolenfeuer ist zu hören.
„Jetzt haben wir die
Sauerei", wendet sich der Hauptmann an seinen Adjutanten. „Hören Sie
selbst: Gefechtslärm! Die Iwans sind bei den 401ern durchgebrochen."
Irles Adjutant nimmt den Hörer
und preßt ihn ans Ohr. Er wird bleich.
„Die Russen haben es also
doch geschafft", sagt Irle. „Bleiben Sie am Apparat. Viel Hoffnung habe
ich zwar nicht, daß sich dieser Uhlmann noch einmal meldet, aber wir müssen
versuchen, mit ihm in Verbindung zu bleiben."
„Jawohl, Herr
Hauptmann."
Der Telefonhörer gibt auch
weiterhin nichts anderes preis als sich stetig steigernden Gefechtslärm, der
dann und wann von rauen Rufen und Kommandos unterbrochen wird.
Unteroffizier Uhlmann aber
meldet sich nicht - vorerst jedenfalls nicht.
Während an der Westfront der
Newa die Kämpfe mit unverminderter Heftigkeit anhalten, ist auch die 2.
sowjetische Stoßarmee zum Angriff angetreten. Sieben russische Divisionen
berennen die deutschen Stellungen zwischen Lipki am Ladogasee und Gaitolowo nördlich
der Kirow-Bahn.
Im Brennpunkt dieser Angriffe
steht das Grenadierregiment 287 (GR 287), das zur 207. Sicherungsdivision gehört.
Das am Eckpfeiler dieser
Verteidigungsfront fechtende II. Bataillon Grenadierregiment 287 kann seine dünn
besetzten Stellungen trotz wütender und massierter Angriffe der Sowjets
erfolgreich verteidigen. Doch südlich, wo das I. Bataillon des ostpommerschen
Grenadierregiments 374 kämpft, gelingt den Sowjets plötzlich ein tiefer und
gefährlicher Einbruch.
Breit gefächert stoßen
sowjetische Infanterie- und Panzerverbände durch die Einbruchslücke. Die
Russen stürmen und trommeln mit „Ratsch-Bumm" und schweren
Granatwerfern die abgeschnittenen Kompanien und Stützpunkte zusammen. Wo es
nicht gelingt, die in Rundumverteidigung kämpfenden Stützpunkte im ersten
Ansturm niederzuwerfen, werden diese von den Gardeschützen (meist asiatischen
Einheiten) eingekreist oder auch einfach umgangen, liegengelassen, um sie zu
einem späteren Zeitpunkt zu liquidieren.
Einzelne Funksprüche, die nach
hinten dringen, berichten von furchtbaren Kämpfen.
Im Verlauf des Vormittags kommt
es schließlich zu allem Unglück auch beim III. Bataillon GR 374 zu einer
neuen russischen Schwerpunktbildung. Hier stürmen die Rotarmisten der 327.
Schützendivision. Ihr Kommandeur heißt Oberst Poljakow.
Er ist einer der
profiliertesten Regimentskommandeure. Ein kühler Rechner, ein mutiger Draufgänger,
aber auch ein vorzüglicher Taktiker. Wochenlang vor der Offensive hat
Poljakow die Stellungen des III. Bataillons GR 374 sowie die
Verteidigungsanlagen von Oberst Wenglers Grenadierregiment 366 erkunden
lassen. In generalstabsmäßiger Kleinarbeit haben seine Leute ein
wirklichkeitsgetreues Modell dieser Stellungen im Sandkasten nachgebaut, und
zwar in allen Details - mit Palisadenzäunen, Laufgräben, zahlreichen
MG-Bunkern und Gefechtsständen.
An der Naht zwischen beiden
deutschen Regimentern setzt Oberst Poljakow nun den Hebel an. Aus einem
kleinen Wäldchen, das sich hervorragend für eine gedeckte Annäherung
eignet, stürmen seine Schützen. Ihre Kampfparole heißt: „Rache für den
Spätsommer des Jahres 1942!"
Damals hatten sich die
Sturmregimenter der 54. sowjetischen Armee eine fürchterliche Niederlage
geholt. Diese Schlappe, von den Sowjets nie verschmerzt und vergessen, soll
jetzt ausgewetzt werden.
Im Durchbruchsraum der 207.
Sicherungsdivision herrschen zur Zeit chaotische Zustände. Nach vorsichtigen
Schätzungen der Divisionsführung sind etwa vier starke Stützpunkte vom
Feind überrollt und eingeschlossen. Ihre Kampfkraft kann aber nicht entbehrt
werden. Andererseits muß angenommen werden, daß sich die Stützpunkte nur für
kurze Zeit halten können, denn sie verfügen nur über wenig Nahrungsmittel,
außerdem reicht ihre Munition keinesfalls länger als ein oder zwei Tage.
Die Division erteilt angesichts
dieser Lage den Stützpunktbesatzungen den Befehl, sich nach Westen durchzukämpfen,
um Anschluß an die eigenen Linien zu bekommen.
Eine besonders dramatische
Episode verdient festgehalten zu werden. Gemeint ist der waghalsige und kühne
Ausbruch des Stützpunkts Tscherniskaja. Tscherniskaja ist ein winziges Dorf,
unmittelbar hinter der deutschen HKL.
Entgegen den sonstigen
Gepflogenheiten wurde der Ort nicht von den Zivilisten geräumt, da diese zu
den Deutschen in einem besonders freundschaftlichen Verhältnis stehen und
wochen- und monatelang unter schwierigsten Bedingungen mitgeholfen haben, die
deutschen Winterstellungen auszubauen.
Tscherniskaja geriet sofort bei
Beginn der sowjetischen Offensive in den Strudel der Vernichtungsschlacht. Den
Stützpunktverteidigern, angeführt von einem jungen Hauptmann, gelang es, als
„Wellenbrecher" alle noch so wütend geführten Angriffe der Sowjets
abzuwehren. Nach drei vergeblichen Sturmangriffen befahl der russische
Regimentskommandeur, das Dorf liegenzulassen und einzukesseln.
Von diesem Zeitpunkt an begann
das große Leiden. Die Sowjets brachten Artillerie heran, die pausenlos in das
Dorf hineinschoß, bis alle Häuser dem Erdboden gleichgemacht waren. Der Stützpunkt,
darüber ist sich der junge Hauptmann nun im klaren, kann sich nicht halten.
Jeder Mann besitzt noch fünfzehn Schuß Gewehrmunition, pro MG stehen 2000
Schuß zur Verfügung. Das Schlimmste aber ist: Im Stützpunkt liegen über
dreißig Verwundete in Schneelöchern, in eiskalten Kellern, die notdürftig
mit Stroh ausgeschüttet sind.
Da trifft der Funkspruch der
Division ein: „Setzen Sie sich bei Einbruch der Dunkelheit in Richtung Südwesten
ab. Wir bereiten alles vor."
Das ist gut und schön, aber
der Hauptmann braucht einen Arzt. Das Stöhnen, Wimmern und Schreien der
unversorgten Verwundeten ist nicht mehr zu ertragen. Ein einziger Sanitätsdienstgrad
bemüht sich um
die Kameraden, aber er kann
ihnen keine Linderung verschaffen, weil
weder Medikamente noch das
allernötigste Verbandszeug da sind.
So funkt der Hauptmann an die
Division: „Wir brechen aus, aber schickt uns einen Arzt.
Die Not der Verwundeten ist
schrecklich."
Der Stab der Sicherungsdivision
nimmt Verbindung zur Armee auf, und diese schickt einen Stabsarzt.
Dr. Ruderfels läßt sich vom
la der Division die Lage - soweit sie bekannt ist - erklären. Der erfahrene
Truppenarzt hat keine Illusionen, „Es gibt nur eine einzige Möglichkeit,
dem Stützpunkt und den Verwundeten zu helfen: Ich muß mit einem Friesler
,Storch' eingeflogen werden."
„Den können Sie notfalls
haben, Doktor", antwortet der la und heftet den Blick forschend auf sein
Gegenüber. „Aber was dann? Die Zeit drängt! Sie können unmöglich allein
über dreißig Verwundete versorgen."
„Das habe ich auch nicht
vor", sagt Stabsarzt Dr. Ruderfels. „Die Verwundeten müssen raus ins
Lazarett, denn nur dort kann man ihnen helfen."
„Und wie sollen diese armen
Kerle den Durchbruch überstehen, Doktor?"
„Besorgen Sie mir eine
Maschine, das andere wird sich finden", erklärt
der Stabsarzt.
Die Nahaufklärerstaffel stellt
einen „Storch" unter der Bedingung zur Verfügung, daß die Maschine spätestens
bis zehn Uhr abends wieder
zurück ist. Die „Aktion
Schwalbenflug"
(Deckname)
wird nach sorgfältiger
Vorbereitung gestartet.
Der Doktor steckt sich die
Taschen voll Pervitin und wird nach Einbruch der Dämmerung in den
eingeschlossenen Stützpunkt geflogen. Die Russen merken nichts. Sie glauben,
die Maschine sei einer ihrer „Leukoplastbomber".
Inzwischen sind im Stützpunkt
alle Vorkehrungen für den Ausbruch getroffen worden. Die Schlittenkolonne
steht bereit. Spähtrupps haben vorsichtig die russische Sicherungskette
abgetastet und tatsächlich eine Lücke darin gefunden.
Stabsarzt Dr. Ruderfels
verteilt seine Pervitintabletten
(ein starkes Aufputschmittel, welches das natürliche
Schlafbedürfnis für längere Zeit aufhebt, bei Mißbrauch jedoch schwere Schädigungen
hervorruft)
an die Landser und Verwundeten.
Da erscheint eine Stunde vor
Abmarsch überraschend der Dorfälteste beim Stützpunktkommandanten. Er hat
Wind davon bekommen, daß die Deutschen das Dorf verlassen und zu den eigenen
Linien durchbrechen wollen. Händeringend bittet er den Hauptmann, doch alle
Bewohner mitzunehmen. Der Hauptmann hält dem Mann vor Augen, in welche Gefahr
sich die Männer, Frauen und Kinder begeben, wenn sie den Durchbruch mitmachen
würden. Er verweist auf die Eiseskälte, den Schneesturm und auf die Möglichkeit,
in einen Kugelregen der Russen zu geraten. Umsonst. „Lieber im Schnee
umkommen und sterben als denen in die Hände fallen", sagt der Dorfälteste.
Der Mann hat sicherlich recht.
Auf Kollaboration mit dem Feind* steht bei den Sowjets der Tod oder zumindest
Straflager. Was soll der junge Hauptmann tun? Nimmt er die Frauen und Kinder
mit, geht er das Risiko ein, daß diese eine Gefahr und eine Behinderung für
die Truppe werden. Andererseits kann er Menschen, die monatelang treu und
zuverlässig die Kümmernisse eines Stellungskrieges miterduldet haben, nicht
vor den Kopf stoßen. Er berät sich mit dem Doktor, der aber meint: „Das müssen
Sie allein entscheiden, Herr Hauptmann. Sie tragen die Verantwortung."
Der Hauptmann bringt es nicht
übers Herz, die Dorfbewohner ihrem Schicksal zu überlassen, und setzt den
Aufbruch für neun Uhr an.
Inzwischen ausgesandte Spähtrupps
haben erkundet, daß die russischen Sicherungsposten sich zum großen Teil in
die umliegenden kleinen Wälder zurückgezogen haben, das Dorf aber nach wie
vor unter Beobachtung des Gegners stehe.
So geräuschlos wie möglich
verläßt die aus siebenundzwanzig Schlittengespannen bestehende Kolonne die
Ortschaft. Verwundete, ältere Frauen mit Kleinkindern und Säuglingen dürfen
fahren, gezogen von männlichen Dorfbewohnern und Soldaten.
Entlang der Kolonne stapfen in
Schützenreihe die Grenadiere, die Waffen schußbereit. Schneeschuhstreifen
fahren voraus, um die Lage zu erkunden.
Es gelingt tatsächlich, durch
die vorher genau erkundete russische Postenkette zu schlüpfen, wobei freilich
die Witterungsverhältnisse zum Bundesgenossen der Flüchtenden werden.
Heulend fegt ein Schneesturm über das Land, und es herrscht rabenschwarze
Dunkelheit.
Über drei Stunden ist der
Elendszug schon unterwegs, ohne mit den sowjetischen Truppen in Berührung zu
kommen. Der Hauptmann und der Stabsarzt laufen unermüdlich an der Kolonne
entlang und muntern den einen oder anderen auf, dessen Kräfte zu versagen
drohen. Im großen und ganzen haben beide nicht viel Mühe, denn das Pervitin
sorgt dafür, daß keine vorzeitigen Ermüdungserscheinungen auftreten.
Gegen drei Uhr morgens
schrecken Landser und Zivilisten zusammen: Motorengebrumm ist zu hören.
„Halt! Nicht bewegen. Alles
volle Deckung!"
Scheinwerfer reißen die
Dunkelheit auf. Es ist eine Gruppe von T-34-Panzern, die der Flüchtlingskolonne
entgegenrollt. Aus, vorbei! denken Landser und Zivilisten entsetzt. Das
drohende mahlende Geräusch der Panzerketten kommt näher und näher. Bald
werden die Scheinwerfer des vorausfahrenden Panzers die im Schnee liegenden
Gestalten erfassen.
„Panzernahkampftrupps nach
vorn", befiehlt der Hauptmann. Sieben „Ofenrohre" hat er zur Verfügung,
und er ist fest entschlossen, sie einzusetzen.
Da! Keine 100 Meter vor der
Spitze der Kolonne drehen die russischen Panzer mit einemmal nach Norden ab,
verschwinden in der Dunkelheit.
Die Zivilisten bekreuzigen
sich, die Soldaten können es zunächst noch nicht fassen.
Aber dann kommt das
Morgengrauen. Weit kann die Kolonne von den eigenen Linien nicht mehr entfernt
sein, denn deutlich sind Maschinengewehr- und Granatwerferfeuer zu hören.
Auch Leuchtzeichen ziehen schemenhaft ihre Bahn durch das Zwielicht.
Jetzt wird die Situation gefährlich,
aber Eile tut not. Der Doktor und der Hauptmann drängen: „Nehmt eure
letzten Kräfte zusammen! Gleich haben wir's geschafft."
Da geschieht das, was der
Hauptmann insgeheim längst erwartet hatte. Von hinten kommt der Ruf: „Wir
werden verfolgt! Russische Schneeschuhstreifen hinter uns!"
Ein ganzes Bataillon jagt
hinter der Kolonne her. In ihrer weißen Tarnkleidung huschen die sibirischen
Schützen über den Schnee. Es wäre ein leichtes für sie, die Landser und
Zivilisten mit MG-Feuer niederzumachen, aber offenbar liegt den Sowjets daran,
die Flüchtenden lebend in die Hand zu bekommen.
Immer kürzer wird der Abstand
zwischen den Verfolgern, durchtrainierten, kräftigen Männern, und dem
Elendszug der Deutschen. Siebenhundert Meter, sechshundert Meter. Hauptmann
und Stabsarzt kommen bereits überein, mit einer zwanzig Mann starken Gruppe
den Kampf gegen das heranrückende russische Skibataillon aufzunehmen, um den
eigenen Kameraden durch hinhaltenden, wenn auch aussichtslosen Widerstand die
weitere Flucht zu ermöglichen.
In diesem kritischen Augenblick
erkennen vorgeschobene
Gefechtsposten
der 227. Infanteriedivison Flüchtende und Verfolger. In Sekundenschnelle
wird die eigene Artillerie alarmiert, die vorgeschobenen Artilleriebeobachter
geben ihre inzwischen ermittelten Schußwerte durch. Und dann heulen die
Granaten von vier Haubitzenbatterien den Sowjets entgegen. Diese geraten in
Verwirrung, jagen auseinander. Aber das deutsche Artilleriefeuer läßt sie
nicht mehr aus dem Griff. Granate um Granate heult zwischen die Russen, die
sich schließlich zurückziehen müssen. Völlig erschöpft erreichen die
Landser des Stützpunkts Tscherniskaja schließlich die eigene HKL. Sie haben,
zusammen mit den russischen Zivilisten, den Durchbruch geschafft, aber unter
welchen Opfern!
Obgleich die Verwundeten -
viele sind unterwegs unbemerkt gestorben - und die Erfrierungsfälle sofort
in das nächste Lazarett gebracht werden, kommt für manchen jede ärztliche
Hilfe zu spät.
Von siebzig Deutschen und
dreiundvierzig russischen Zivilisten hat nur zirka ein Viertel die Flucht
durch Eis, Sturm und Schnee überstanden. Ein bitteres Schicksal. Dennoch
sind die Überlebenden glücklich, der Gefahr, in russische Gefangenschaft zu
geraten, entgangen zu sein.
Dutzende deutscher Stützpunktbesatzungen,
die von der eigenen Front abgeschnitten waren, hatten bereits am ersten Tag
ebenfalls Versuche unternommen, zu den deutschen Linien durchzubrechen.
Einigen gelang es, die meisten jedoch wurden von den Sowjets unterwegs
gestellt, zusammengeschossen oder in die Gefangenschaft abgeführt.
Wieder andere hatten sich in
ihren kleinen Schneeburgen oder in winzigen Waldstücken festgesetzt, und
verteidigten sich mit dem Mut der Verzweiflung gegen die immer wieder anstürmenden
Russen. Kaum einer dieser Stützpunkte besaß noch Funkverbindung zu seinem
Regiment oder zur Division. Sie kämpften auf verlorenem Posten, und sie wußten
das. Trotzdem hofften sie insgeheim, ein Entlastungsangriff der Kameraden würde
sie aus ihrer schrecklichen Lage befreien. Eine Hoffnung, die nur in wenigen
Fällen Erfüllung finden sollte.
Anderthalb Kilometer tief und
zwei Kilometer breit ist die Durchbruchsstelle bei Marino. Nennenswerter
Widerstand wird kaum noch geleistet. Die sowjetische Angriffswalze rollt, die
befürchtete Krisensituation im Raum der 18. deutschen Armee ist
eingetreten.
Generalmajor Duchanow erhält
die Nachricht vom Durchbruch zu einer Zeit, da er längst alle Hoffnungen
aufgegeben hatte, daß seine Gardeschützen jemals das Ostufer der Newa
erreichen würden.
„Das ist fürchterlich",
hatte er noch vor 30 Minuten zu seinem Stabschef gesagt, der ihm die
Verlustziffern der Gardeschützenregimenter bekanntgab. „Allein im Raum
Marino-Gorodok über 3000 Tote und Verwundete! Eine niederschmetternde
Bilanz!"
Und jetzt diese überraschende
Wende!
Generalmajor Duchanow erkennt
die sich ihm bietende Chance. Er handelt sofort und befiehlt: „Alle verfügbaren
Regimenter in den Durchbruchsraum. Panzer und schwere Waffen nach vorn."
Duchanow nimmt sogar das Risiko
auf sich, die Reste der 86. Schützendivision, die vor Schlüsselburg kämpft,
von dort abzuziehen und in die Lücke zu werfen.
Innerhalb weniger Stunden
schafft so der Oberkommandierende der 67. russischen Armee die Masse von
insgesamt drei Elite-Schützendivisionen in den Einbruchsraum.
Sein letzter Befehl lautet:
„Alle Panzerabteilungen überqueren die Newa, stoßen den Infanterieverbänden
nach, um dann nach Norden, Süden und Osten auszufächern."
Das hört sich einfach an. In
der Praxis jedoch stehen diesem Befehl schier unüberwindbare Schwierigkeiten
im Weg. Die Newa ist an der Einbruchsstelle 800 Meter breit. Bis über zwei
Meter hoch liegt teilweise der Schnee. Da und dort hat ihn der Wind zu
regelrechten fest vereisten Barrieren zusammengepreßt. Hinzu kommt noch, daß
der Fluß an verschiedenen Stellen von den Deutschen vermint worden ist. Außerdem
gibt es Flächen, wo sich das Eis so stark geworfen hat, daß kein Fahrzeug
darüber hinwegkommt.
Diese Hindernisse hatte die
deutsche Führung in ihren Verteidigungsplan einkalkuliert. Die ganze
Abwehrtaktik konzentrierte sich deshalb mehr oder weniger auf angreifende
Feindinfanterie. Mit der Möglichkeit, die Sowjets könnten kurzfristig Panzer
und schwere Waffen ins Gefecht bringen, wurde nicht gerechnet.
Generalmajor Duchanow,
dynamisch und von unerbittlicher Härte, löst dieses Problem auf seine Art.
Mit Spezialpioniereinheiten rückt er den Hindernissen auf der Newa zu Leibe.
Schneepflüge, Bulldozer, ganze Bataillone von zivilen Arbeitskommandos -
vorwiegend Komsomolzenverbände (sowjetischen
Jugendorganisation) -
schaufeln, baggern und pflügen Panzerfurten frei, ebnen das holprige Eis der
Newa ein. Währenddessen beginnen Minenspezialisten der 67. sowjetischen
Armee mit der Räumung zahlreicher Minenfelder. Ein tödliches Geschäft. Alle
paar Minuten rumst es, fliegt eine Mine in die Luft, werden Menschen in Fetzen
gerissen, verstümmelt.
Generalmajor Duchanows
Panzerarmada steht mit laufenden Motoren am Westufer der Newa. Die Meute der
stählernen Ungetüme muß in die Schlacht geworfen werden, ehe die Deutschen
ihrerseits Gegenmaßnahmen ergreifen können. Jede vergeudete Minute kann über
Sieg oder Niederlage entscheiden.
Das noch vor wenigen Stunden
weit entfernte Operationsziel der Sowjets ist nun, nach dem geglückten
Durchbruch, in greifbare Nähe gerückt. Diese einmalige Chance läßt sich
Duchanow nicht entgehen.
Von seinem vorgeschobenen,
fliegenden Gefechtsstand aus verfolgt er mit Ungeduld die Räumungsarbeiten.
„Schneller, schneller!"
Ordonnanzen flitzen los, überbringen
Befehle, die alle denselben Tenor aufweisen: „Macht nicht so langsam, sonst
steht der Sieg auf dem Spiel, und alle bisherigen Blutopfer sind umsonst
gewesen."
Die Pioniere und
Arbeitsbrigaden schuften bis zum Umfallen. Zäh, verbissen, fluchend bewältigen
sie in zweieinhalb Stunden das ihnen abverlangte Mammutprogramm. Eher als
Duchanow angenommen hatte, wird ihm gemeldet:
„Newa minenfrei. Der Fluß
kann von den Panzern überquert werden."
Generalmajor Duchanow kann
zufrieden sein. Er gibt grünes Licht für seine T 34 und für die
mechanisierten Verbände, für die Mot.-Artillerie.
„Auf zu den Sinjawino-Höhen!
Schlagt die Faschisten!"
Mit dieser Kampfparole brausen
die sowjetischen Panzerverbände los. Sie preschen mit heulenden Motoren über
das Eis der Newa und erscheinen zu einem Zeitpunkt auf dem Schlachtfeld, als
die deutsche Führung das ganze Ausmaß des Fiaskos noch nicht einmal annähernd
erkennen kann.
Über die tief verschneite
Moor- und Steppenlandschaft jagt ein Geländekübel.
Der Fahrer holt alles aus dem
Wagen heraus. Er manövriert ihn in halsbrecherischer Manier über vereiste
Schneelöcher, so daß er einige Male umzukippen droht.
Neben dem Fahrer sitzt
Oberstleutnant Dr. Kleinhenz, der Kommandeur des Grenadierregiments 401, und
hinten im Fond kauert der Regimentsadjutant, die schußbereite MPi auf den
Knien.
Beide Offiziere befinden sich
auf dem Weg in die vorderste Linie, in den Einbruchsraum.
„Ich muß versuchen zu
retten, was noch zu retten ist", hatte Dr. Kleinhenz seinem
Regimentsstab eröffnet, als das Ausmaß der Katastrophe offenbar geworden
war.
„Erlauben Sie mir, daß ich
Sie begleite, Herr Oberstleutnant?" hatte der Adjutant seinen Chef
gefragt und dessen Zustimmung erhalten. „Vielleicht gelingt es uns,
wenigstens da und dort eine Widerstandslinie aufzubauen."
Der Adjutant bewundert die
Entschlossenheit und den Mut seines Kommandeurs. Andere würden in solch einem
Fall ihren Gefechtsstand zurückverlegen und im übrigen die „Entwicklung
der Lage" abwarten.
Der Oberstleutnant sucht mit
dem Glas das Gelände ab, ganz auf seine Aufgabe konzentriert. Ein Blick auf
sein Gesicht läßt die Sorge über den Zusammenbruch seines Regiments
offenbar werden.
Der Fahrer, der den Kübel
immer noch mit Vollgas voranjagt, sieht kurz herüber.
„Wie weit noch? Das Gelände
wird immer schwieriger", stellt er besorgt fest. Doch er bekommt keine
Antwort.
Es geht jetzt auf die Höhe 348
zu, die in vier Kilometern Breite das Gelände von Westen nach Osten
durchschneidet.
„Dort rauf!" befiehlt
der Oberstleutnant.
Sofort legt der Fahrer den Geländegang
ein, gibt vorsichtig Gas. Aber alle Kunst nützt hier nichts, der klapprige Kübel
schafft die Steigung nicht, die Räder rutschen durch.
Da läßt Dr. Kleinhenz
anhalten. „Stoßen Sie zurück", befiehlt er dem Mann am Steuer, „und
warten Sie hier auf uns. Wenn wir in einer Stunde nicht da sind, fahren Sie
zum Gefechtsstand zurück."


Der Fahrer sagt, er würde
nicht ohne seinen Kommandeur abhauen, aber Dr. Kleinhenz besteht auf seiner
Anordnung. „Das ist ein Befehl", wendet er sich an den Obergefreiten
und winkt seinem Adjutanten. „Kommen Sie!"
Vom Kamm der Höhe aus werfen
beide einen Blick auf das vor ihnen liegende Gelände. Es ist der
Verteidigungsabschnitt des I. und II. Bataillons. Er erstreckt sich zwei
Kilometer tief bis zur Newa hin. Welliges, unübersichtliches Steppenland mit
einigen kleinen Schluchten. Dazwischen stützpunktartig verteilte
Kampfbunker, Gräben, zur Rundumverteidigung eingerichtete MG-Stellungen,
die sich in ihrem Wirkungsbereich überlappen. Dahinter aber ist leerer
Raum.
In diesem Augenblick pfeift es
heran und schlägt rechts neben den Offizieren ein. „Weg von hier!"
befiehlt Dr. Kleinhenz. „Wenn wir in gerader Richtung weitergehen, müssen
wir auf die Gefechtsstraße des I. Bataillons stoßen. Das sind meiner Schätzung
nach höchstens noch 700 Meter."
Minuten später sind sie im größten
Schlamassel. Ringsherum kracht es. Einschläge, daß die Erde bebt. Eruptionen
aus Erdbrocken und Schnee. Die Russen schießen aus Dutzenden von Rohren
Sperr- und Vernichtungsfeuer, um zu verhindern, daß das GR 401 seine
Eingreifreserven
heranführt, die freilich nicht existieren. Oberstleutnant Dr. Kleinhenz
besitzt nicht einen Zug Reserve, den er in den Kampf hätte werfen können.
Der Adjutant sieht seinen
Kommandeur fragend an, doch der zuckt nur die Schulter.
„Es hilft alles nichts, mein
Lieber. Wir müssen durch das Artilleriefeuer. Los!"
Sie rennen, daß ihnen die
Zunge aus dem Hals hängt, werfen sich, wenn es gar zu dick kommt, vorübergehend
in Deckung, springen dann wieder auf und laufen weiter.
Einmal geraten sie in den
Feuerschlag einer „Stalinorgel". Die Welt scheint unterzugehen. Aber
sie überleben es.
„Da haben wir aber noch mal
Schwein gehabt", sagt der Oberstleutnant mit rauer Stimme. „Weiter!
Gleich haben wir's geschafft."
Und tatsächlich tackern plötzlich
vor ihnen Maschinengewehre. Aber es sind russische. „Vorsicht, Herr
Oberstleutnant!" warnt der Adjutant.
Doch da peitschen in rasender
Schußfolge MG-Feuerstöße.
„Das ist ein MG 42, Herr
Oberstleutnant." Der Adjutant ist heilfroh, endlich auf eigene Leute zu
stoßen.
Unter dem Scheitelkamm eines
niedrigen Höhenrückens, in einer Linie nebeneinander kniend, sind an die
zwanzig Grenadiere damit beschäftigt, Deckungslöcher auszuheben. Russische
Maschinengewehre beharken sie. Aber die Soldaten scheren sich nicht drum.
„Die sind ja wähnsinnig!"
stößt Dr. Kleinhenz entsetzt hervor. Unwillkürlich bleiben er und sein
Adjutant stehen.
Angeführt wird die Gruppe von
einem jungen Leutnant, dessen Kampfanzug über und über mit Blut besudelt
ist. Das rechte Hosenbein ist aufgefetzt, darunter ein blutdurchtränkter
Verband. Das Gesicht des Offiziers ist fahl, hager, von einem Dreitagebart
umwuchert.
Auf einen Knüppel gestützt,
gibt er mit ruhiger Stimme seine Befehle, weist den etwas abseits von der
schanzenden Gruppe in Stellung gegangenen MG-Schützen ein, aufrecht stehend
und dem feindlichen Feuer ausgesetzt.
Entweder ist dieser Offizier
schon so fertig, daß er nicht mehr bemerkt, welcher Gefahr er sich aussetzt,
oder er hat Nerven wie Drahtseile.
Dr. Kleinhenz kann es nicht
mehr mit ansehen, wie die Maschinengewehrgarben rechts und links von dem
Leutnant den Boden furchen. Er rennt geduckt auf ihn zu und brüllt: „Nun
gehen Sie schon in Deckung, Leutnant!"
Dieser, sich schwer auf den Knüppel
stützend, wendet langsam den Kopf.
Als er den Regimentskommandeur
erkennt, strafft sich seine hagere Gestalt. Die linke Hand geht mechanisch zum
Stahlhelmrand, dann meldet er:
„Melde gehorsamst: Leutnant
Krause, I. Bataillon, 3. Kompanie, mit einundzwanzig Mann und einem MG."
Der Kommandeur des GR 401
erwidert die Ehrenbezeigung.
„Danke. Aber jetzt runter in
Deckung!" befiehlt er fast schroff.
Da lächelt der Leutnant bitter
und antwortet:
„Geht leider nicht, Herr
Oberstleutnant. Wenn ich erst mal unten bin, komme ich so schnell nicht wieder
hoch. Da bleibe ich also lieber stehen."
Dem Regimentskommandeur schnürt`s
die Kehle zusammen. Er begegnet dem brennenden, spöttisch-trotzigen Blick
dieses Leutnant Krause, den er nie zuvor gesehen hat, und weiß keine
Antwort.,
Der MG-Schütze jagt wieder
einen Feuerstoß hinaus. - Ein russisches Maxim-Gewehr antwortet kurz, aber
die Geschosse gehen hoch übers Ziel hinaus. Noch einmal schießt der MG-Schütze,
dann brüllt er dem Leutnant zu: „Geschafft! Die hauen ab, Herr
Leutnant!"
„Feuer einstellen!"
befiehlt Krause. Und sich an die schanzenden Grenadiere wendend: „Nun
macht voran, Jungs. Lange dauert es bestimmt nicht, dann kommen sie
wieder."
Nach diesem Befehl scheint sich
der Leutnant wieder des anwesenden Regimentskommandeurs zu erinnern. Nach
einem schnellen Blick in die Runde humpelt er Dr. Kleinhenz entgegen, aber
dieser winkt ab.
„Nicht doch, Herr Leutnant.
Ich habe noch gesunde Beine." Er geht auf den jungen Offizier zu und schüttelt
diesem beide Hände. Es ist eine für ihn außergewöhnliche Geste - gefühlsmäßige
Reaktionen sind sonst nicht seine Sache.
Krause, durch die Spontaneität
seines Regimentskommandeurs sichtlich gerührt, ist eisern bemüht, sich
nichts davon anmerken zu lassen. Betont forsch wendet er sich an den
Oberstleutnant.
„Darf ich mir gehorsamst
erlauben, Herrn Oberstleutnant in die Lage einzuweisen?"
„Ja! Ich bitte darum",
antwortet Dr. Kleinhenz.
Krauses Bericht bringt wenig Klärung.
Nach mehrmaligem Artilleriefeuerschlag brach die vorderste Uferstellung
zusammen, und die Russen griffen in Stärke von mindestens zwei Bataillonen
an. Zusammengehauene Stellungen, Panik bei den schwachen Kompanien, die Hälfte
aller MG außer Gefecht, Verwundete, Tote, sämtliche Fernsprechverbindungen
unterbrochen. Und massenhaft angreifende Rotarmisten. Erbitterte Nahkämpfe.
Dies alles ist für Dr.
Kleinhenz nichts Neues. Interessant hingegen ist Krauses Hinweis, daß die
Russen in zwei starken Stoßkeilen angreifen, offenbar in der Absicht, das GR
401 in zwei Teile zu zerschneiden.
„Merkwürdigerweise
marschierten die russischen Angriffsspitzen nicht wie erwartet weiter südwärts,
sondern sie drehten ein", weiß der Leutnant noch zu berichten. Er mutmaßt
folgerichtig: „Die Erklärung für dieses sonderbare Verhalten ist wohl die:
Die Russen beabsichtigen, den Verteidigungsraum unseres Regiments vollends in
ihre Hand zu bekommen, ehe sie weiterstoßen. Oder die Infanterie verhält, säubert
den Kampfraum, bis die Panzer nachgekommen sind."
„Ich fürchte fast, Sie haben
recht", murmelt Dr. Kleinhenz nachdenklich. Die Frage, wo sich der nächste
Bataillonsgefechtsstand befinde, kann der Leutnant nicht beantworten. Er erzählt
in knappen Umrissen, wie es ihm selbst erging. Drei sowjetische Kompanien
standen gegen die 3. Kompanie, die aus 45 Mann bestand und nach halbstündigem
Kampf aufgerieben war, zusammengeschossen, in alle Winde zerstreut. Der
Kompaniechef fand den Tod. Er, Leutnant Krause, konnte sich mit vier Mann nach
Südwesten durchschlagen; bei einem Zusammenstoß mit einer vorgeprellten
russischen Sturmgruppe wurde er verwundet: Oberschenkelsteckschuß. Dann
stießen er und seine vier Männer auf Versprengte, die sich ihnen sofort
anschlossen.
„Aus welchen Einheiten?"
will Dr. Kleinhenz wissen.
„Ich hatte noch keine Zeit,
danach zu fragen, Herr Oberstleutnant."
„Und was spielt sich hier
ab?" fragt Dr. Kleinhenz.
„Wir befinden uns 800 Meter südwestlich
der H-Linie
(ein Gelände, das ursprünglich einmal als Auffangstellung für
das I. Bataillon gedacht war), und nördlich von uns liegt Moorgelände,
rechts abgegrenzt durch einen Höhenzug, der panzersicher ist", erwidert
Leutnant Krause.
„Ich kenne dieses Gelände
wie meine eigene Hosentasche, weil ich es selbst mit erkundet habe", fährt
Krause fort. „Hervorragendes Schußfeld bis über 900 Meter, Herr
Oberstleutnant. Wenn wir uns entsprechend gut eingegraben haben, können wir
die Russen eine ganze Weile halten."
„Und die Knallerei
vorhin?" erkundigt sich Dr. Kleinhenz.
„Ohne Bedeutung, Herr
Oberstleutnant", erklärt Krause. „Ein russischer Spähtrupp, fünfzehn
Mann stark. Wir konnten ihn abwehren."
Dr. Kleinhenz nickt. „Dies
hier ist wirklich eine ausgezeichnete Riegelstellung, aber die Russen werden
wiederkommen, Artillerie einsetzen, vielleicht sogar Panzer ... und Sie sind
verwundet, Krause", sagt der Oberstleutnant besorgt. „Sie gehören
eigentlich auf den Hauptverbandsplatz. Wie lange wollen Sie das durchhalten?
Und wenn Sie aus den Stiefeln kippen, was dann? Sie haben nicht einen
Unteroffizier, der das Kommando übernehmen könnte."
„Ich denke vorerst auch nicht
daran, das Kommando abzugeben, Herr Oberstleutnant", erwidert Krause fast
schroff. „Und was meine Verwundung angeht - es ist meine vierte, wenn ich
das gehorsamst feststellen darf. Ich weiß ganz genau, was ich mir zumuten
kann. Abgesehen davon, Herr Oberstleutnant: Irgendwann muß sich die Division
wohl dazu aufraffen, einen Gegenstoß zu starten. Bis dahin können Herr
Oberstleutnant auf mich zählen."
„Ich werde versuchen, Ihnen
Verstärkung zu schicken", wendet sich der Oberstleutnant wieder an den
Kommandoführer und schüttelte ihm nochmals die Hand. Dann geht er hinüber
zu den Landsern und tut das gleiche auch bei diesen. Wortlos! Jede
Aufmunterung hätte wie eine Phrase gewirkt. Und die Landser verstehen ihren
Regimentskommandeur. „Mach dir mal keine Sorgen um uns", scheinen
ihre Blicke auszudrücken. „Wichtiger ist, daß du dein Regiment, falls es
ein solches überhaupt noch gibt, wieder in den Griff bekommst."
Das sollte Oberstleutnant Dr.
Kleinhenz jedoch nicht möglich sein.
Wie katastrophal die Lage sich
inzwischen entwickelt hat, erkennt der Regimentskommandeur spätestens, als er
mit seinem Adjutanten in der Absicht, den Widerstand wenigstens an einigen
Stellen neu zu organisieren, weiter in den Einbruchsraum vordringt.
Nachdem beide Offiziere die
sogenannte H-Linie - jenen schmalen Höhenrücken, an dessen westlichem Ende
Leutnant Krause mit einer Handvoll Grenadiere Riegelstellung bezogen hat - überquert
haben, liegt vor ihnen das Schlachtfeld in seiner ganzen Breite und Tiefe: die
Bunkerlinien, die Drahtverhaue, inzwischen in Fetzen geschossen, die
zahlreichen,
aber kleinen Stützpunkte, die Verteidigungsnester.
In diesem Gelände brodelt -
nach kurzer Gefechtspause - wieder die Schlacht. Wohin das Auge auch blickt:
Einschläge, Qualmwolken, die zuckenden Leuchtspurgarben der Maschinengewehre
und - massenhaft russische Infanterie. Sie kämpft, schwärmt aus und
marschiert. In riesigen Kolonnen, die bis zum Newa-Ufer reichen.
Am Gefechtslärm kann Dr.
Kleinhenz erkennen, daß deutscher seits nur noch vereinzelt Widerstand
geleistet wird. Am linken Flügel, an der Nahtstelle zwischen I. und II.
Bataillon, geht sowjetische Artillerie in Stellung. Und daneben, durch das
Glas deutlich sichtbar, fährt Pak auf.
Erregt über dieses Fiasko und
entschlossen, zu retten, was noch zu retten ist, eilt Dr. Kleinhenz mit
seinem Adjutanten nach vorn. Es kommen ihnen Trupps von Verwundeten entgegen,
abgekämpfte, mutlos gewordene Gestalten, denen noch das Grauen in den Augen
sitzt, kaum ansprechbar und nur von dem einen Wunsch besessen: Fort aus dieser
Hölle!
Dr. Kleinhenz läßt sie
ziehen. Die meisten von ihnen bemerken den Oberstleutnant gar nicht. Sie
trotten stumpf davon, apathisch gewordene Opfer der Schlacht.
Einige fragt der Oberstleutnant
nach der Einheit, woher sie kommen,
wo die Russen
stehen, wo der nächste deutsche Gefechtsstand liege. Die
Antworten sind so
widersprüchlich, daß er es aufgibt. Das Fazit der
Aussagen: Es geht
alles drunter und drüber, und der Russe greift von
allen Seiten an!
Einige hundert Meter weiter stößt
Dr. Kleinhenz auf zirka vierzig Mann, die - voll bewaffnet und von einem
Oberfeldwebel angeführt -zurückgehen. Da weit und breit keine Russen zu
sehen sind, gerät Dr. Kleinhenz begreiflicherweise in Zorn.
Die MPi im Anschlag, stellt er
sich den Zurückgehenden entgegen und brüllt den Oberfeldwebel an:
„Was für ein Sauhaufen ist
das? Etwa Ihrer, Oberfeldwebel?"
In der Erregung hervorgestoßen,
ist des Oberstleutnants Ton verletzend. Der mit beiden Eisernen Kreuzen
ausgezeichnete Oberfeldwebel scheint es gar nicht zu bemerken. Erstaunt darüber,
einen Stabsoffizier so weit vorn anzutreffen, nimmt er Haltung an und sagt:
„Zum Teil sind es meine
Leute, Herr Oberstleutnant, zum Teil Versprengte. Ich weiß nicht, woher sie
kommen."
„Warum geht ihr zurück?"
fragt Dr. Kleinhenz.
„Es sind Melder vom I.
Bataillon an uns vorbeigekommen, die haben gesagt, russische Panzer
kommen", antwortet der Oberfeldwebel.
„Und da haut ihr einfach
ab?" fragt der, Oberstleutnant in scharfem Ton.
„Erlaube mir zu bemerken,
Herr Oberstleutnant, daß es weiter vorn überhaupt keinen Zweck hat, in
Stellung zu gehen. Wenn die Panzer wirklich anrollen, machen die Mus aus
uns."
„Und wo wollen Sie dann in
Stellung gehen?" fährt ihn Dr. Kleinhenz an.
„Am besten wäre es diesseits
der H-Linie, Herr Oberstleutnant", lautet des Oberfeldwebels Antwort.
„Kehrt marsch, und alles mir
nach!" befiehlt der Kommandeur des GR401. Und der Oberfeldwebel
antwortet: „Wie Herr Oberstleutnant befehlen. Ich darf aber noch einmal
darauf aufmerksam machen, daß es in dieser Richtung nicht ein einziges
Deckungsloch gibt. Außerdem ist das Gelände vom Feind eingesehen."
Wie sich gleich darauf zeigt, hätte
Dr. Kleinhenz besser daran getan, die Warnung des Oberfeldwebels ernst zu
nehmen.
Keuchend, in immer schnellere
Gangart verfallend, stapfen Dr. Kleinhenz, sein Adjutant, der Oberfeldwebel
und die Grenadiere durch den knietiefen Schnee auf eine ziemlich flache
Bodenerhebung zu, die - weil sie gutes Schußfeld bietet - dem Oberstleutnant
zur Verteidigung geeignet erscheint.
Umsonst warnt der Oberfeldwebel
noch einmal: „Vorsicht! Da sind wir auch eingesehen."
„Zum Teufel, Oberfeldwebel, können
Sie mir eigentlich sagen, was hier nicht von den Russen eingesehen ist?"
erwidert der Regimentskommandeur hitzig und wohl in dem Glauben, der Mann übertreibe
absichtlich.
Doch kaum haben sie die oben
abgeplattete Bodenerhebung erreicht, rauscht es schon heran und schlägt vor
ihnen ein. Donnernde, gar nicht weit entfernte Abschüsse mehrerer Geschütze
und Sekunden später krachende Einschläge. Rechts und links, hinten und vorn.
Die krepierenden Granaten streuen einen Splitterregen, der zirpend
herumfliegt und neben den Grenadieren in den Schneeboden patscht.
„Verdammt gut gezielt. Die
wollen sich diesen verfluchten Hügel freihalten", brüllt der Adjutant
seinem Kommandeur zu.
„Einzeln zurückarbeiten!"
befiehlt der Oberstleutnant, der nun eingesehen hat, daß hier auf dieser
Erhebung, auch wenn sie für eine Verteidigung noch so günstig ist, kein
Blumentopf zu gewinnen ist.
Etwa 60 Meter setzen sie sich
ab, aber die Russen stellen das Feuer nicht ein. Sie streuen mit ihren Geschützen
das Gelände ab, so daß niemand seinen Standort auch nur um einen Meter verändern
kann. Das Genick eingezogen, den Körper an den Boden gepreßt, mit hellwachem
Bewußtsein jeden Einschlag registrierend und wehrlos dem Splitterhagel
ausgesetzt, liegen sie da. Doch diesmal kommen sie alle noch mit dem Schrecken
davon. Genauso schlagartig, wie das Artilleriefeuer einsetzte, hört es wieder
auf.
„Gott sei Dank, das hätten
wir überstanden", sagt erleichtert und so laut, daß es alle hören können,
der Adjutant.
Kaum hat er den Satz zu Ende
gesprochen, reißt es den Oberfeldwebel vom Boden hoch. „Panzer!" ruft
er.
Mit einem Satz ist auch Dr.
Kleinhenz auf den Beinen, lauscht, schüttelt unwillig den Kopf, weil ihm
noch die Ohren dröhnen und brausen.
„Es sind Panzer, Herr
Oberstleutnant", wiederholt der Oberfeldwebel und blickt seinen
Regimentskommandeur fragend an.
Jetzt hören auch die anderen
das Geräusch vieler Motoren. Die Luft ist angefüllt vom Kreischen der
Panzerketten.
„Das sind schätzungsweise
zwanzig Panzer", wendet sich der Oberfeldwebel an seinen
Regimentskommandeur.
„Los, rauf auf den
Buckel", kommandiert Dr. Kleinhenz und gibt dem Adjutanten und dem
Oberfeldwebel einen Wink.
Eng an den Boden gepreßt,
liegen die drei im Schnee und spähen mit den Gläsern nordwärts.
Es sind T 34 und zwei KW I,
insgesamt 14 Stück, die rasch durch den Schnee heranrollen und dann plötzlich
aus allen Waffen feuern.
„Die machen alle zur Sau, die
noch vorn in den Löchern liegen", kommentiert der Oberfeldwebel die
heranbrausende Panzerarmada.
„Wir müssen von hier
weg", sagt der Adjutant erregt und erntet ein bitteres Lachen des
Oberfeldwebels.
„Wohin denn? Es gibt weit und
breit keine Deckung, und bis zur H-Linie schaffen wir es keinesfalls."
Es bleibt ihnen also keine
andere Wahl, als sich hinter der Bodenerhebung in den Schnee zu legen und
abzuwarten.
Kaum zehn Minuten später sind
die Panzer da. Sie pflügen durch den metertiefen Schnee, schleudern ihn in
flutenden Wellen hoch und kommen unaufhaltsam näher.
Von dem Häuflein deutscher
Infanteristen nehmen sie keine Notiz. Die russischen Panzerkommandanten mit
ihren Lederhelmen stehen bis zur Hüfte im Turm. So sicher fühlen sie sich.
„Da fahren sie dahin und
kommen hoffentlich nicht wieder", sagt der Regimentsadjutant und atmet
schwer.
In diesem Augenblick geschieht
es. Der Panzerkommandant des letzten T 34 dreht sich zufällig im Turm um.
Den Deutschen stockt der Herzschlag. Sie sind erkannt worden.
Aufkreischen der bremsenden
Raupenketten. Ein Hagel weggeschleuderter Eisbrocken. Der T 34 stellt sich
quietschend quer. Dann Kommandos, nur undeutlich im Lärm der Motoren zu hören.
Der schwere Turm schwenkt herum, und Sekunden später ein brüllender Abschußknall.
Nicht mehr als vier
Sprenggranaten verwendet der russische Panzerkommandant, dann dreht der T 34
wieder bei und braust den anderen Kampfwagen nach.
Fünf Grenadiere des GR 401
sind tot, drei mehr oder minder schwer verwundet. Unter den Verwundeten
befinden sich auch Oberstleutnant Dr. Kleinhenz und sein Adjutant.
Das GR 401 hat seinen
Kommandeur verloren.
Im Hauptquartier des AOK 18
(Armeeoberkommando 18)
sind eben die letzten Meldungen über die russische
Newa-Offensive eingegangen.
Generaloberst Lindemann, den
Blick auf die Lagekarte gerichtet, auf der die roten Pfeile eine allzu
deutliche Sprache sprechen, ist über das Ausmaß der Katastrophe bestürzt.
Mit einem einzigen Blick ist zu ersehen, was sich im Verteidigungsraum der 18.
Armee für eine verhängnisvolle Entwicklung abzeichnet.
Lindemanns Stabschef skizziert
denn auch in seinem Lagevortrag treffend und nüchtern die gegenwärtige
Situation in wenigen Sätzen:
„Anhand der vorliegenden
Meldungen von der Front beabsichtigt General Goworow (Oberkommandierender der
Wolchow-Front), alle verfügbaren Kräfte seiner Armee in die Einbruchslücke
bei Marino zu werfen. Das Ziel dieser klar erkennbaren Operation: Durchstoß
durch den »Flaschenhals und
Vereinigung mit den aus Osten angreifenden Verbänden. Dann Abschwenken nach Süden,
um unsere Verteidigungsstellungen an der Newa und an der Ostseite unserer
Front aufzurollen.
Daraus ergeben sich zwangsläufig
folgende erste Angriffsschwerpunkte: Erstens die Arbeitersiedlung Poselok 5
an unserer Ostflanke. Hier müssen die Russen schwerpunktmäßig angreifen,
weil da die einzige brauchbare Straße sowohl nach Norden zum Seeufer hin
als auch nach Süden zu den Sinjawino-Höhen und zur Kirow-Bahn führt.
Zweitens:
Angriffsschwerpunkt Raum Gorodok und Elektrizitätswerk. Hier blockieren wir
den Russen den direkten und kürzesten Weg zu den Sinjawino-Höhen."
„Und ausgerechnet an diesen
Stellen haben wir nur schwache Kräfte zur Verfügung", wirft
Generaloberst Lindemann mit leiser Stimme ein und beginnt im Lageraum auf und
ab zu gehen.
„Sowohl bei Poselok 5 als
auch bei Gorodok können wir uns bestenfalls 24 Stunden halten, Herr
Generaloberst", gibt der Stabschef zu bedenken.


In
diesem Augenblick geschieht es. Der Panzerkommandant des letzten T 34 dreht
sich zufällig im Turm um. Den Deutschen stockt der Herzschlag. Sie
sind erkannt worden.
Aufkreischen der bremsenden
Raupenketten. Ein Hagel weggeschleuderter Eisbrocken. Der T 34 stellt sich
quietschend quer. Dann Kommandos, nur undeutlich im Lärm der Motoren zu hören.
Der schwere Turm
schwenkt herum, und Sekunden später
ein brüllender Abschußknall.
Nicht mehr als vier
Sprenggranaten verwendet der russische Panzerkommandant, dann dreht der T 34
wieder bei und braust den anderen Kampfwagen nach.
Fünf Grenadiere des GR 401
sind tot, drei mehr oder minder schwer verwundet. Unter den Verwundeten
befinden sich auch Oberstleutnant Dr. Kleinhenz und sein Adjutant.
Das GR 401 hat seinen
Kommandeur verloren.
Im Hauptquartier des AOK 18 (Armeeoberkommando 18)
sind eben die letzten Meldungen über die russische
Newa-Offensive eingegangen.
Generaloberst Lindemann, den
Blick auf die Lagekarte gerichtet, auf der die roten Pfeile eine allzu
deutliche Sprache sprechen, ist über das Ausmaß der Katastrophe bestürzt.
Mit einem einzigen Blick ist zu ersehen, was sich im Verteidigungsraum der 18.
Armee für eine verhängnisvolle Entwicklung abzeichnet.
Lindemanns Stabschef skizziert
denn auch in seinem Lagevortrag treffend und nüchtern die gegenwärtige
Situation in wenigen Sätzen:
„Anhand der vorliegenden
Meldungen von der Front beabsichtigt General Goworow (Oberkommandierender der
Wolchow-Front), alle verfügbaren Kräfte seiner Armee in die Einbruchslücke
bei Marino zu werfen. Das Ziel dieser klar erkennbaren Operation: Durchstoß
durch den »Flaschenhals* und Vereinigung mit den aus Osten angreifenden Verbänden.
Dann Abschwenken nach Süden, um unsere Verteidigungsstellungen an der Newa
und an der Ostseite unserer Front aufzurollen.
Daraus ergeben sich zwangsläufig
folgende erste Angriffsschwerpunkte: Erstens die Arbeitersiedlung Poselok 5 an
unserer Ostflanke. Hier müssen die Russen schwerpunktmäßig angreifen, weil
da die einzige brauchbare Straße sowohl nach Norden zum Seeufer hin als auch
nach Süden zu den Sinjawino-Höhen und zur Kirow-Bahn führt. Zweitens:
Angriffsschwerpunkt Raum Gorodok und Elektrizitätswerk. Hier blockieren wir
den Russen den direkten und kürzesten Weg zu den Sinjawino-Höhen."
„Und ausgerechnet an diesen
Stellen haben wir nur schwache Kräfte zur Verfügung", wirft
Generaloberst Lindemann mit leiser Stimme ein und beginnt im Lageraum auf und
ab zu gehen.
„Sowohl bei Poselok 5 als
auch bei Gorodok können wir uns bestenfalls 24 Stunden halten, Herr
Generaloberst", gibt der Stabschef zu bedenken.
„Die einzige denkbare Maßnahme,
die russische Walze zu bremsen, ist der sofortige Gegenstoß, Herr
Generaloberst", fordert der Stabschef. „Andernfalls..."
„Ja, ja, ich weiß, was Sie
sagen wollen. Andernfalls bekommen wir eine zweite Stalingrad-Auflage",
unterbricht ihn der OB der 18. Armee gereizt.
„Dies muß allerdings befürchtet
werden", sagt der Stabschef und sucht Lindemanns Blick.
Sofortiger Gegenstoß, Einsatz
der einzigen Armeereserve! Eine Gleichung mit vielen Unbekannten! Aber
Lindemann, ein illusionsloser und nüchterner Armeeführer, weiß
andererseits nur zu gut, was auf dem Spiel steht, wenn die russischen Stoßkeile
nicht zum Stehen gebracht werden. Schweren Herzens sagt der Generaloberst
schließlich:
„Also gut. Rufen Sie sofort
die 96. Infanteriedivision ab. Noeldechen soll noch heute Abend aus dem Raum
Sinjawino in nordwestlicher Richtung angreifen. Die ,Tiger* und die
Acht-acht-Flak (8,8 cm) werden unterstellt."
\
Damit sind die Würfel
gefallen. Aber Lindemann ist nicht wohl bei dem Gedanken, seine Reserve schon
jetzt ins Gefecht schicken zu müssen, zumal die 96. ID nicht die volle
Gefechtsstärke besitzt, sondern nur mit fünf Grenadierbataillonen antreten
kann. Und das nicht einmal im geschlossenen Einsatz, weil die Division nach
Lage der Dinge auf mehrere Schwerpunkte verteilt werden muß. Seinem
Tagebuch vertraut der Generaloberst an: „... ich bin also wieder einmal
gezwungen, die verhängnisvolle Strategie listenreicher Flickschusterei zu
betreiben. Es wird zusammengekratzt, was noch vorhanden ist, statt mit Großverbänden
zum erfolgversprechenden Gegenschlag auszuholen."
Bei der 96. ID löst der
Einsatzbefehl keine Überraschung aus. In wochenlanger, generalstabsmäßiger
Kleinarbeit hat General Noeldechen, der Kommandeur der 96. ID, den
„X-Tag" vorbereitet.
Seit sich die Anzeichen auf
russischer Seite mehrten, daß die Sowjets eine Großoffensive auf den
„Flaschenhals" von Schlüsselburg ins Auge faßten, hatte Noeldechen
Teile seiner Division noch näher an die möglichen Schwerpunkte
herangezogen. So war beispielsweise das Grenadierregiment 284, zeitweilig
der 170. ID unterstellt, schon Anfang Januar mit seinem III. Bataillon in das
„Scheidislager" gezogen, während das II. Bataillon auf den
Sinjawino-Höhen in Bereitstellung ging.
Auch Teile der
Divisionsartillerie wurden aus dem Abschnitt der 1. ID herausgezogen und in
den Abschnitt der 170. ID verlegt, um die Arbeitersiedlungen P 3, P 2, P l,
P 5 und P 7 abzuschirmen.

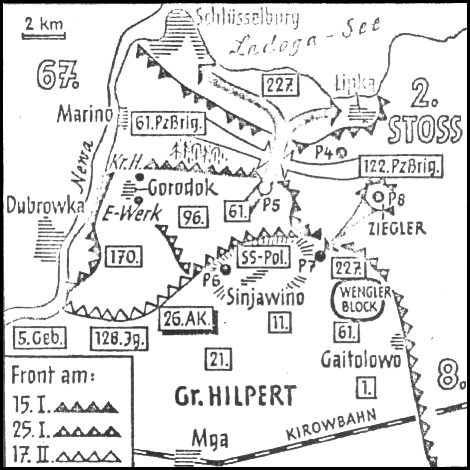
Mit großer Sorgfalt waren
zudem noch die voraussichtlichen Anmarschwege in die Kampfräume erkundet und
markiert worden. Regelmäßig durchgeführte Alarmübungen brachten die
Bataillone auf schnellste Einsatzbereitschaft.
Nach menschlichem Ermessen
konnte kaum mehr etwas schiefgehen. Die 96. ID war für den Einsatz gerüstet.
Doch es kam anders.
Die für General Noeldechen
wohl größte und auch bitterste Überraschung war die mächtige Feuertiefe
des russischen Artillerieschlags. Das um 7.20 Uhr schlagartig einsetzende
Trommelfeuer des Feindes traf nicht nur die im vordersten Verteidigungsraum
eingesetzten Bataillone und Kompanien, es ging wie ein Hagelsturm auch auf die
rückwärtigen Waldlager nieder, in denen die Reserven lagen. Mit
unvorstellbarer Wucht prasselte es auf die Anmarschwege, ackerte diese um und
zerschlug nicht zuletzt die Feuerräume des Artillerieregiments 196.
Schwer heimgesucht wurde
obendrein noch das II. Bataillon GR 284, das, wie schon erwähnt, auf den
Sinjawino-Höhen in Bereitstellung lag.
Als das gefechtsführende XXVI.
AK (General d. Inf. von Leyser) den Befehl übermittelt bekam, die 96. ID noch
in dieser Nacht in den Kampf zu werfen, war dieser Befehl schon nicht mehr
durchführbar.
In einem Blitzgespräch
schilderte General von Leyser dem OB der 18. Armee die veränderte Situation
bei der 96. ID. Der Angriffsbefehl wurde daraufhin zurückgenommen, als neuer
Termin der Morgen des 13. Januar festgelegt.
Eine bittere Sache für die
ganze Armee, deren Schicksal nach wie vor am seidenen Faden hing, denn die im
Kampf stehenden Divisionen waren gegenwärtig einer Belastung ausgesetzt, die
an der Grenze des menschlich und militärisch Zumutbaren lag.
Aber selbst wenn General
Noeldechen sich über die Schwierigkeiten hinweggesetzt hätte, wäre es unmöglich
gewesen, die 96. ID zeitgerecht zum Einsatz zu bringen, weil der Gegner alle
Anmarschwege unter pausenloses Stör- und Vernichtungsfeuer genommen hatte.
Kein einziges Bataillon wäre ungeschoren in den Bereitstellungsraum gekommen.
Angesichts dieser Lage blieb
dem Korps und der Division nur die Hoffnung, nach Einbruch der Dunkelheit
losmarschieren zu können.
Inzwischen verstrich aber
kostbare Zeit, gingen Stunden verloren, die sehr leicht zum berühmten Zünglein
an der Waage werden konnten.
Sieben Stunden ist die Schlacht
an der Newa alt, als die Lage bei den deutschen Verteidigern den bislang
kritischsten Punkt erreicht.
Vor allem bei Gorodok, dem
Zentralstück der deutschen Verteidigungsfront, sieht es böse aus. Das hier
fechtende Pionierbataillon 240 unter Major Schulz, der seinen Gefechtsstand im
E-Werk aufgeschlagen hat, erlebt die Hölle.
Oberleutnant Winackers 2.
Pionierkompanie, die das Krankenhaus und das umliegende Gelände verteidigt,
ist am Ende. Die Munition wird knapp. Die Verwundetenzahl steigt stündlich.
Winackers Lage ist besonders
schwierig, weil er im Verlauf der unübersichtlichen Kämpfe zwei Züge
verloren hat, die nordostwärts abgedrängt worden sind und somit der Kompanie
bei ihrer schweren Verteidigungsaufgabe fehlen.
Oberleutnant Winacker hat zwar
einen Zug der Radfahrschwadron 240 als Verstärkung erhalten und darüber
hinaus auch noch zwei Gruppen Versprengte der Kampfgruppe Garsten, aber sie
ersetzen nicht die zwei Züge.
So geschwächt, hat es Winacker
nicht verhindern können, daß russische Gardeschützenbataillone bis zum Wäldchen
vordringen konnten, das unmittelbar neben dem Krankenhaus liegt und eigentlich
nie vom Feind hätte besetzt werden dürfen. Als der Oberleutnant von zwei
losgeschickten Spähtrupps die Meldung erhielt, daß es in dem Waldstück von
Russen nur so wimmelte, hatte er nur gesagt: „Nun ist die Schweinerei
perfekt."
Ihre Chance blitzschnell
wahrnehmend, hatten die Sowjets Pak und 7,62-cm-Geschütze ins Wäldchen
gebracht und beschießen nun ohne Unterbrechung die schwachen
Widerstandslinien von Winackers 2. Pionierkompanie.
Ihre Methode, den Widerstand
der Deutschen im Krankenhausbereich zu brechen, ist denkbar einfach und
wirkungsvoll: zuerst vier, fünf Minuten toller Feuerzauber auf die erkannten
Stellungen der Deutschen, dann blitzschneller Angriff mit kampfstarken Stoßtrupps,
die aus MPi-Schützen und Flammenwerfertrupps zusammengesetzt sind.
Zwar war es Winackers Pionieren
bis jetzt gelungen, alle Einbruchs-
und Durchbruchsversuche abzuwehren, aber wie lange die Kräfte seiner
wenigen Leute noch ausreichen werden, das ist ungewiß.
Als Major Schulz, der
Kommandeur des Pionierbataillons 240, Oberleutnant Winacker einen Besuch
abstattet und die verzweifelte Situation des kleinen Häufleins sieht, ist er
entsetzt.
„Brendel und seine 3.
Kompanie müssen her", wendet er sich an Oberleutnant Winacker. „Das
schaffen Sie nie allein."
„Wenn das möglich wäre,
Herr Major, hätte ich nichts dagegen", antwortet Winacker und fügt
hinzu: „Aber es muß schnell gehen, Herr Major. Ich kann für nichts mehr
garantieren."
„Brendel ist spätestens in
einer Stunde da", verspricht der Major. Und er hält sein Wort. Brendels
3. Kompanie eilt zur Verstärkung herbei. Oberleutnant Winacker atmet auf, schöpft
wieder Hoffnung.
In einer „fliegenden
Lagebesprechung" kommen Winacker und Brendel überein, daß die
Befestigung der Krankenhausgebäude und die Absicherung des umliegenden Geländes
vorrangig sind.
Beides wird sofort in Angriff
genommen. In dieser kritischen Situation beweisen die Männer des
Pionierbataillons 240, daß sie zu Recht „Handwerker der Schlachten"
genannt werden.
In kürzester Zeit verwandeln
Brendels Pioniere das Krankenhaus in eine waffenstrotzende und feuerspeiende
Festung. In den Fensternischen werden Maschinengewehr- und Scharfschützen
postiert, kugelsichere Brustwehren errichtet und die Kellerfenster so massiv
verbarrikadiert, daß sie selbst Pak-Beschuß aushalten können.
Um das Krankenhaus herum aber
verlegen die Pioniere ihre letzten Minen, und das bei höchster Lebensgefahr,
unter starkem Beschuß russischer Maschinengewehre und Granatwerfer.
Kaum sind Brendels Männer mit
ihrer Arbeit fertig, beginnt sich das teuflische Karussell wieder zu drehen.
Mörderischer Pak- und
Granatwerferbesphuß setzt ein. Dann ganze Salven der „Ratsch-Bumm"
(7,62 cm). - Der Dachstuhl des Krankenhauses fängt Feuer. - Unter dem Beschuß
der Pak bröckelt die Frontseite des Krankenhauses ab. Die Granaten reißen
riesige Löcher heraus.
Danach greifen die Gardeschützen
mit lautem Kampfgeschrei an.
Die Rotarmisten, ganz
offensichtlich der Meinung, diesmal ein leichtes Spiel zu haben, erleben eine
herbe Abfuhr. Als sie in Kompaniestärke bis an die Minensperre herangekommen
sind, eröffnen Winackers und Brendels Pioniere das Feuer, tackern die
Maschinengewehre, bellen ihnen die Gewehrschüsse der Scharfschützen
entgegen.
Der sowjetische Angriff endet
blutig. Zu Dutzenden fallen die Russen, zu Dutzenden wälzen sich Verwundete,
gellend nach Hilfe schreiend, im Schnee.
Wieder einmal ist das Ärgste
verhindert worden, hat die schwache deutsche Front bei Gorodok standgehalten.
Pioniere eines einzigen Bataillons haben einen zehnfach überlegenen Gegner
abgewehrt und keinen Meter Boden abgegeben.
Rechts vom Pionierbataillon 240
liegt Hauptmann Irles AA 240. Mit den Resten seiner Aufklärungsabteilung hat
er an der Ringstraße Stellung bezogen.
Aufklärungsabteilung und
Pionierbataillon, alles zusammen vielleicht knapp 300 Mann, sind die einzigen
Kräfte, die noch zwischen den Russen und der rückwärtigen deutschen
Kampfzone liegen. Erzielt der Gegner hier einen Einbruch, stehen die
Rotarmisten vor den Feuerstellungen der Divisionsartillerie.
Die AA hält ihre Stellungen.
Zwar rennen auch hier die Russen pausenlos an, hämmern die Granaten von Pak
und Feldgeschützen in die deutschen Feldstellungen, aber die Infanterie der
Russen schafft es nicht. Sie verblutet im Abwehrfeuer von Hauptmann Irles
MG-Schützen oder endet spätestens im erbarmungslosen Nahkampf.
Einmal - zwischen einem
abgeschlagenen Infanterieangriff der Russen und einem eigenen Gegenstoß, bei
dem ein verlorengegangener MG-Stand zurückerobert werden sollte - herrschte
beim 3. Zug der 2. Kompanie beträchtliche Aufregung. Vor den Stellungen des
3. Zuges tauchte plötzlich eine Gestalt auf. Wankend, mit zerfetzter Uniform
und heftig gestikulierend, näherte sich der Mann den deutschen Stellungen.
Der Gefreite Schulze,
misstrauisch und aufmerksam, nahm die seltsame Figur bereits ins Visier
seines MG. Man konnte schließlich nie wissen, auf welche Tricks die Iwans
verfielen. Und dieser Unbekannte kam geradewegs aus der Richtung der Russen.
Schulze ließ den Mann bis auf
80 Meter herankommen, dann rief er ihm zu: „Halt! Stehenbleiben!
Parole!"
Der Angerufene antwortete
nicht, wollte sich jedoch durch heftige Armbewegungen verständlich machen. Da
wurde Schulze nervös. Er hatte schon den Zeigefinger am Abzug, als sein
Gruppenführer ihm in den Arm fiel. „Menschenskind, das ist doch einer von
uns!"
Der Unteroffizier hatte die
Gestalt ebenfalls mit dem Fernglas beobachtet.
Obwohl der Mann in seinem Äußeren
kaum von einem Russen zu unterscheiden war, fiel dem Unteroffizier auf, daß
er keine Walinkis
(Filzstiefel)
trug, sondern Knobelbecher.
Kein Rotarmist würde bei
dieser Kälte einen Lederstiefel anziehen.
Schulze, immer noch skeptisch,
wiegte den Kopf hin und her. „Und wenn's doch 'n Iwan ist und der Kerl eine
Mine unter der Weste trägt?"
„Armleuchter", sagte der
Unteroffizier nur und rief dem Mann, der aus dem Niemandsland kam, zu, er möge
sich beeilen, sonst würden ihm die Russen noch einen verplätten. Doch der
Mann hob nur hilflos die Hände. Gleich darauf brach er etwa 30 Meter vor dem
MG-Stand zusammen.
„Los, komm mit, wir holen ihn
rein. Der ist ja fix und fertig", sagte der Unteroffizier.
Der Soldat, der mit letzter
Kraft die deutschen Linien erreicht hatte, war Unteroffizier Uhlmann. Sie
brachten ihn sofort zum Gefechtsstand von Hauptmann Irle, der aus allen Wolken
fiel, als sich dieses abgerissene Lumpenbündel, das sich kaum auf den Beinen
halten konnte, noch einmal zusammenriß und stammelnd hervorbrachte:
„Unteroffizier Uhlmann, zwotes Bataillon GR 401, zur Stelle." Dann
konnte er nicht mehr und kam ins Wanken.
Zwei Melder fingen ihn auf und
legten ihn auf eine Pritsche.
„Los, Decken und Schnaps her,
den Sani holen! Und zieht ihm die Stiefel aus", sagte der Hauptmann zu
den im Gefechtsstand anwesenden Meldern und Fernsprechern. Die Männer legten
den bewußtlosen Kameraden auf eine Pritsche.
Wegen besonderer Tapferkeit vor
dem Feind wurde Unteroffizier Uhlmann später im Divisionsgefechtsbericht
lobend erwähnt, zum Feldwebel befördert und mit einer Auszeichnung bedacht.
Die Angriffe der Russen im Raum
Gorodok lassen in den ersten Nachmittagsstunden beträchtlich nach. Offenbar
machen sich jetzt doch die enormen Verluste bemerkbar. Als auch nach Einbruch
der Dämmerung keine weiteren Großangriffe sowohl im Einbruchsraum wie auch
im Abschnitt Gorodok bei AA 240 und Pionierbataillon 240 unternommen werden
und der Gegner sich lediglich auf Artillerie- und Granatwerferfeuerüberfälle
beschränkt, atmen Führung und Truppe erleichtert auf.
Es sieht so aus, als sei das Ärgste
überstanden, und zuversichtlich sehen die Landser der 170. und 227. ID dem
neuen Tag entgegen, der durch den Einsatz der 96. Infanteriedivision die große
und entscheidende Wende im Kampf um die Newa-Front bringen soll.
Laut Armeebefehl soll der
Gegenstoß der 96. ID aus der Linie „Scheidislager" - Raum Gorodok -
angesetzt werden. Zum Einsatz gelangen rechts das GR 284 unter Oberst Pohlman
mit dem III. Bataillon (Oberleutnant Ruprecht), dem I. Bataillon GR 287
(Oberleutnant Mensing) und II. Bataillon GR 284 (Hauptmann Dresp), links GR
283 unter Oberst Andoy mit dem III. Bataillon und dem II. Bataillon. Dem
divisionseigenen Artillerieregiment 196 werden zusätzlich unterstellt: II.
und III. Abteilung AR 240 der 170. ID. Das AR 196 selbst kann einsetzen: IV.
Abteilung AR 196, ferner die 3. Batterie (im Unterstellungsverhältnis) der
schweren Artillerieabteilung 641 und die II. Abteilung Flak Regiment 36. Hinzu
kommen außerdem noch die „Tiger" der 1. Kompanie Panzerabteilung 502,
verstärkt durch Panzer III.
Eine stattliche Feuerkraft, möchte
man meinen. Doch darf nicht vergessen werden, daß diese auf einen verhältnismäßig
großen Raum verteilt werden muß. Außerdem ist die gegnerische Artillerie
inzwischen - durch
Gefangenenaussagen bestätigt - in einem Maße verstärkt worden, daß dem
Gegner schätzungsweise über 400 Rohre zur Verfügung stehen.
Die mittlerweile herangezogenen
russischen Panzerverbände sind in diesem Vergleich gar nicht berücksichtigt.
Aber gerade die Panzer werden in der bevorstehenden Auseinandersetzung
zweifellos den Ausschlag geben. Wie viele Panzer der Oberkommandierende der
Wolchow-Front bereitgestellt hat, konnte nicht ermittelt werden. Korps und
Armee schätzen jedoch, daß die Sowjets etwa anderthalb Panzerregimenter in
den Kampf werfen können.
Anderthalb Panzerregimenter
gegen vier „Tiger"-Panzer, acht Panzer III und eine Abteilung
8,8-cm-Flak!
Der Stabschef des XXVI.
Armeekorps sagte angesichts dieses Kräfteverhältnisses: „Wie gehabt - der
Kampf Davids gegen den Riesen Goliath. Der Himmel sei uns gnädig."
Noch in der Nacht vom 12. auf
den 13. Januar gibt es die erste Panne. Die X-Zeit, auf 7 Uhr früh angesetzt,
muß verschoben werden. Neuer Angriffstermin: 9.30 Uhr.
Was war geschehen?
Die Bataillone der 96. ID
konnten ihre Bereitstellungsräume nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt erreichen.
Katastrophale Wegverhältnisse und der starke Beschuß russischer schwerer
Artillerie, der die ganze Nacht über anhielt und vorher nicht einberechnete
Umwege notwendig machte, waren die Ursache hierfür.
Der Stabschef des XXVI.
Armeekorps ist sich mit dem Kommandeur der 96. ID darin einig, daß die
Verschiebung der Angriffszeit verhängnisvolle Folgen haben kann, falls die
Sowjets dem deutschen Gegenstoß zuvorkommen und ihrerseits sofort beim
Morgengrauen ihre Angriffsoperationen fortsetzen.
Dagegen sprechen zwar einschlägige
Ic-Meldungen des Korps, die allesamt besagen, daß der Gegner infolge der
schweren Verluste gezwungen worden sei, auf breiter Front umzugruppieren.
Ziemlich genaue Recherchen von Korps und Armee hatten ergeben, daß die
sowjetischen Verluste an Toten und Verwundeten am ersten Kampftag zirka 10 000
Mann betrugen.
Der Kommandierende General des
XXVI. Armeekorps, General der Inf. von Leyser, schätzte die Feindlage
folgendermaßen ein:
„Nach diesen Verlusten halte
ich es für unwahrscheinlich, daß die Russen
vor dem Mittag des 13. Januar ihre Operationen weiter fortsetzen. Meine
Herren, die kochen auch nur mit Wasser."
Hauptmann Sipjadom hatte nach
dem Tod seines Regimentskommandeurs das Regiment nur einige Stunden lang geführt.
Es war ihm gelungen, die versprengten und stark dezimierten Bataillone
(Gefechtsstärken rund 50 Mann)
zu sammeln und wieder einigermaßen Ordnung zu
schaffen. Fast alle Kompaniechefs waren gefallen. Von den drei
Bataillonskommandeuren lebte noch einer, und auch der war verwundet, führte
aber weiterhin.
Sipjadom hatte die Bilanz des
1. Kampftages gezogen. Die errechneten Verlustziffern, Waffenbestand,
Munitionsbestand, augenblickliche Gefechtsstärke - all das ging mit
Sonderkurier an die Division mit der Bitte um weitere Befehle.
Statt der Befehle erscheint
Major Proskatow, der Divisionspolitkommissar, in Sipjadoms Gefechtsstand am
Newa-Ufer.
Ohne sich um den jungen
Hauptmann zu kümmern, schnallt Proskatow seine Meldetasche ab, öffnet die
Lederschlaufen und zieht zwei dichtbeschriebene Meldeblattformulare hervor.
Sipjadom sieht mit einem Blick,
daß es seine eigene Meldung ist, die er an die Division geschickt hat.
„Sie erkennen natürlich Ihre
eigenen Schriftzüge", sagte Proskatow und hebt den Blick.
„Allerdings, Genosse
Major."
„Gut! Machen wir es kurz. Auf
Befehl der Division übernehme ich ab sofort das Regiment. Das ist das
eine." Und auf die Meldeblattformulare zeigend, fährt er fort: „Dieses
da habe ich mitgebracht, weil ich mich davon überzeugen will, ob Ihre Angaben
den Tatsachen entsprechen."
„Bisher hat noch kein
Vorgesetzter an meiner Korrektheit gezweifelt ..."
Der Politkommissar zuckt die
Schultern.
„Das mag sein. Ich persönlich
habe da andere Vorstellungen. Schließlich übernehme ich ein Regiment. Und
nun darf ich Sie ersuchen, mit mir die Stellungen des Regiments
abzugehen."
Über eine Stunde lang kriechen
Major Proskatow und Hauptmann Sipjadom durch die Kraterlandschaft. Proskatow
entgeht nichts. Mit penetranter Ausdauer notiert er und vergleicht, spricht
mit den Gardeschützen, läßt sich die Waffen vorzeigen, und erst als die
letzte Gruppe besichtigt ist, kehrt er in den Gefechtsstand zurück.
„Ich hoffe sehr, daß Sie
nach dieser Besichtigung das Regiment beruhigt übernehmen können",
bemerkt Hauptmann Sipjadom.
Der Kommissar überhört den
stummen Vorwurf, holt aus seiner Kartentasche ein versiegeltes Kuvert hervor
und gibt es dem Hauptmann.
„Da drin sind Ihre Beförderungsurkunde
und Ihre Ernennung zum Kampfgruppenkommandeur. Und nun alles Gute. Sie werden
bei der 288. Division erwartet." Sipjadom grüßt und verläßt den
Gefechtsstand.
Eine Stunde später meldet er
sich bei der Division. Die Sipjadom zugeteilte Kampfgruppe besteht aus drei
Infanteriekompanien, einer Spezialpionierkompanie mit sieben Flammenwerfern
und zwölf Panzern vom Typ T 34.
Aufgabe der gemischten
Kampfgruppe: Angriff auf die Arbeitersiedlung Poselok 5. Durchstoß bis zu den
Sinjawino-Höhen. Angriffszeit: 13. Januar, 8 Uhr.
Die Eiligkeit dieses Kommandos
unterstreichend, stellt die Division dem frischgebackenen Major einen
Motorschlitten zur Verfügung, der Sipjadom auf schnellstem Wege zur
Kampfgruppe bringen wird.
Es ist bereits 21 Uhr, als
Major Sipjadom dort eintrifft. Die Einheit liegt 1,5 km nordöstlich des „Scheidiswaldes"
und setzt sich fast ausschließlich aus sibirischen Schützen zusammen. Die
Kompaniechefs sind erfahrene Truppenoffiziere, und Sipjadom hat das Gefühl,
mit ihnen gut zurechtkommen zu können.
Den Kommandeur der T 34 lernt
Sipjadom wenig später kennen, da dieser noch im Unterziehraum der Panzer zu
tun hatte. Es ist ein Hauptmann namens Sachartschy, 25 Jahre alt, die Brust
voller Orden und Medaillen. Ein Draufgänger!
Die erste Lagebesprechung
findet in einem provisorisch wiederhergestellten, ehemaligen deutschen Bunker
statt.
Oberleutnant Dowator, der Chef
der Pionierkompanie, berichtet dem Major über die Ergebnisse der mittlerweile
durchgeführten Spähtruppunternehmen. Die Spähtrupps sind bereits nach etwa
250 Meter auf die deutschen Sicherungen gestoßen, meldet er. Allem Anschein
nach sei die Abwehrfront vor Poselok 5 nicht sehr stark.
Als nächstes unterzieht
Sipjadom seine Kampftruppe einer kurzen Besichtigung, die zu seiner vollen
Zufriedenheit ausfällt. Er hat das Gefühl, daß die Gardeschützen
diszipliniert sind und noch eine erfreulich gute Kampfmoral besitzen.
Nach der Inspektion führt der
Major schließlich noch ein Telefongespräch mit dem für seinen Abschnitt
zuständigen Artilleriekommandeur, der ihm versichert, daß zwei
Artillerieabteilungen den Angriff der Kampfgruppe mit einem zehnminütigen
Feuerschlag vorbereiten werden.
An die 268. Schützendivision
gibt der Major um 02.45 Uhr den Spruch durch: „Letzte Beurteilung der Lage
zwingt mich, Panzer nicht wie vorgesehen in der ersten, sondern in zweiter
Linie einzusetzen."
Dem Funksergeanten befiehlt er:
„Ab 3.00 Uhr bis auf Widerruf abschalten. Die Verantwortung übernehme
ich."
Der Sergeant schiebt Sipjadom
einen Meldeblock hin. „Zu Befehl, Genosse Major. Aber ich darf Sie ersuchen,
diesen Befehl schriftlich zu erteilen. Das ist Vorschrift." .
„Selbstverständlich",
murmelt Sipjadom und kritzelt seinen Namen auf das stück Papier.
Am 13. Januar, morgens um 07.45
Uhr, setzen die Sowjets ihre Angriffe im Durchbruchsraum fort. Eingeleitet
werden sie durch starkes Artilleriefeuer, das den bisherigen Feuerschlägen an
Heftigkeit in nichts nachsteht.
Die gigantische Feuerwalze
erreicht sogar den Gefechtsstand der 96. ID, wo alles zu den tiefen Deckungslöchern
rennt. Zehn Minuten lang schießen die Russen Vernichtungsfeuer auf das
deutsche Hinterland, danach trommeln sie nur noch auf die vorderste HKL.
General Noeldechen, der
Kommandeur der 96. ID, sieht schwarz. Das vorzeitige Antreten der Russen kann
sich zu einer unübersehbaren Katastrophe ausweiten, wenn es diesen gelingen
sollte, in die in der Bereitstellung liegenden Grenadierbataillone hineinzustoßen.
Im Divisionsgefechtsstand
herrscht begreiflicherweise Nervosität. Man wartet auf die ersten Meldungen
von der Front.
Wo bildet der Russe
Schwerpunkte? Greift er mit Infanterie oder Panzern an?
„Voraussichtlicher
Angriffsschwerpunkt wird der Scheidiswald sein", mutmaßt der la der 96.
ID. „Und vielleicht noch Poselok 5", fügt er stirnrunzelnd hinzu.
General Noeldechen nickt,
starrt auf die Lagekarte. „Scheidiswald und Poselok 5. Da stehen doch nur
noch Trümmer der 170. Infanteriedivision und einige zusammengekratzte
Einheiten des überrannten GR 401. Die halten einem Großangriff der Russen
niemals stand, dazu sind sie viel zu schwach."
„Und wenn die Russen
durchbrechen", fügt der la sorgenvoll hinzu, „stehen sie vor den
Feuerstellungen der IV. Abteilung unseres AR 196."
Diese Abteilung steht viel zu
weit vorn. Sie kann im Ernstfall unmöglich einen Stellungswechsel vornehmen
und wird sich - für einen Artilleristen so ziemlich das Schlimmste überhaupt
- mit der blanken Waffe verteidigen müssen. Daß bei einem feindlichen
Durchbruch auch nur ein einziges Geschütz gerettet werden kann, ist dann so
gut wie ausgeschlossen.
Noeldechen hatte mehrmals beim
Korps interveniert und auf die Gefahr hingewiesen, die seiner
Artillerieabteilung droht, aber das Korps ließ ihn wissen: „Das Verbleiben
der IV. Abteilung AR 196 in jetziger Stellung ist aus psychologischen Gründen
unbedingt erforderlich."
In die Truppenpraxis umgesetzt,
heißt das, wenn schon vorn so gut wie nichts mehr liegt, dann sollen die
Landser wenigstens das Gefühl haben, daß die Artillerieabteilung ihren Kampf
unterstützt.
Es ist zwanzig nach acht, als
Leutnant Teske in der Fernsprechzelle der Division den Hörer abnimmt.
„Wer spricht dort? Ich kann
Sie nicht verstehen. Bitte, wiederholen Sie ... Eine Sauverständigung",
knurrt der Leutnant dem Nachrichtenunteroffizier Weber zu. Dann: „Was
sagen Sie? - Jawohl, ich werde die Meldung sofort weitergeben. Danke.
Ende."
Teske wirft den Hörer auf die
Gabel und läuft zum Divisionsgefechtsstand. Sekunden später steht er atemlos
vor dem la.
„Nun, Teske, was
gibt's?"
„Eben kam eine telefonische
Meldung aus dem Abschnitt des GR 401 durch. Der Russe ist am Scheidiswald mit
Panzern und bataillonsstarker Infanterie zum Angriff angetreten. Es muß befürchtet
werden, daß die Feuerstellungen der IV. Abteilung AR 196 unmittelbar bedroht
sind."
„Also doch", sagt der la
nur und tritt an die Lagekarte.
Scheidiswald! Dort liegt nur
eine zusammengewürfelte Alarmeinheit des Oberleutnants Koch. Siebzig oder
achtzig Mann, von denen einer den anderen nicht kennt. Ausgerechnet hier
greifen die Russen mit Panzern und Infanterie an!
Und die Grenadiere des GR 287 können
frühstens in zwei Stunden zur Stelle sein, um diese gefährliche Frontlücke
abzuriegeln.
Zwei Stunden sind eine lange
Zeit...

Zusammen mit seinem
Kompanietruppführer beobachtet Oberleutnant Koch die aus dem 400 Meter
entfernten Wäldchen vor seiner HKL in Gruppen von zwanzig bis dreißig Mann
hervorbrechenden Rotarmisten. Er sieht auch die Panzer, die am Waldrand
aufgefahren sind.
Etwa 100 Meter der HKL
vorgelagert und durch einen tiefen Stichgraben mit dieser verbunden, liegt
eine Datscha
(Landhaus). Darin ein sMG
(schweres Maschinengewehr), dazu vier
Schützen und ein Unteroffizier als Bedienung.
Koch hat das sMG - das einzige,
das er besitzt - in die Datscha verlegt, weil man von dort aus gutes Schußfeld
hat und mühelos den ganzen Waldrand bestreichen kann.
Die Männer in der Datscha müßten
das Feuer längst eröffnet haben. Doch das sMG schweigt. Kein Schuß fällt.
Und die Russen nähern sich dem Haus in Zugstärke.
„Verdammt noch mal, warum
schießen die Kerle nicht?" flucht Oberleutnant Koch. „Was ist los mit
denen? Pennen die etwa?"
„Bei dem Krach? Ganz unmöglich,
Herr Oberleutnant", sagt Unteroffizier Dohrn, Kochs Kompanietruppführer.
„Da stimmt was nicht."
„Ist mir auch klar",
knurrt der Oberleutnant.
„Eines ist auffallend, Herr
Oberleutnant. Während die russische Artillerie bei uns alles kurz und klein
schlug, hat die Datscha nicht mal 'nen Kratzer abbekommen. Dorthin ging nicht
ein einziger Schuß."
Koch blickt seinen
Kompanietruppführer verdutzt an. Dohrn hat recht. Zufall? Koch weiß es
nicht. Er hat jetzt auch keine Zeit, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Das
Gelände wimmelt von Russen. Die T 34 am Waldrand stehen mit laufenden
Motoren, abrufbereit. Höchste Eisenbahn, daß etwas unternommen wird.
„Waldrand und rechts daneben
die Lichtung mit Granatwerfern sperren", befiehlt der Oberleutnant.
„Alle Stützpunkte MG-Feuer frei!"
Dohrn schießt eine grüne
Leuchtrakete - das verabredete Zeichen - in den Himmel.
Schlagartig prasselt das Feuer
der deutschen MG-Schützen auf die Angreifer hernieder, krachen die Gewehrschüsse,
schleudern die Werfer Granaten zum Waldrand hinüber, wo die T 34 auf der
Lauer liegen.
Kochs Grenadiere schießen aus
allen Waffen. Aber der ganze Feuerzauber hat nur dann Wirkung, wenn das sMG in
der Datscha mithält. Mit seinem flankierenden Feuer wäre es für die Russen
gefährlich.
So tritt denn auch das ein, was
Koch längst befürchtete. Die Rotarmisten spritzen auseinander, werfen sich
in Deckung und kommen nun in kleineren Gruppen sprungweise heran; unterstützt
von den Panzern, die mit genau liegendem Punktfeuer die deutschen
MG-Stellungen unter
Beschüß nehmen.
Die Russen wiederum, die sich
der Datscha genähert haben, hasten in eine querlaufende Bodenmulde, wo sie außerhalb
des Wirkungsbereichs der Stützpunkt-MG sind.
„Ich halte das nicht mehr
aus", platzt Kochs Kompanietruppführer plötzlich heraus. „Ich sehe
nach, was bei Spieker los ist, Herr Oberleutnant."
Spieker ist der sMG-Truppführer,
ein zuverlässiger und besonnener Soldat, ein Unteroffizier bewährter Art.
„Das schaffen Sie nicht,
Dohrn", warnt Koch, aber Unteroffizier Dohrn jagt bereits durch eine
Kurzsappe und taucht im Stichgraben unter.
„Zurück, Dohrn! Sind Sie
verrückt geworden?" schreit der Oberleutnant hinter seinem
Kompanietruppführer her.
Rums-wrach!
Rums-wrach!
Die T 34 haben den einzelnen
Mann im Stichgraben ausgemacht und funken nun in den Graben rein, daß die
Fetzen fliegen.
Niemals schafft er das, denkt
Oberleutnant Koch erbittert, denn Dohrn und die sMG-Bedienung sind die
einzigen Männer, die von seinem eigenen Haufen sind, die er kennt und auf die
er sich verlassen kann, wenn es hart auf hart gehen sollte.
Auch Dohrn gibt keinen Heller
mehr für sein Leben. Vor und hinter ihm, rechts und links schlagen die
Panzersprenggranaten ein, sirren die Splitter haarscharf an seinem Kopf
vorbei. Doch er gibt nicht auf. Diese Sache mit Spieker und seinem sMG sitzt
wie ein Stachel in ihm. Ganz abgesehen davon, muß das schwere Maschinengewehr
in den Einsatz kommen, sonst ist hier in dieser belemmerten Stellung der Ofen
gleich aus.


Um die Datscha pfeifen und
heulen nun die Geschoßgarben mehrerer russischer Maschinengewehre.
Die letzten zwanzig Meter
kriecht Dohrn auf dem Bauch, und als er sich der Datscha bis auf wenige Meter
genähert hat, brüllt er: „Spieker! Spieker, was ist los? Melde dich!"
Keine Antwort. Kein Geräusch
aus der Datscha. Dafür wütendes Gebelfer der russischen MG, die mit
Dauerfeuer die Vorderfront des Hauses bepflastern.
Wenig später liegt Dohrn vor
der feindabwärts gewandten Tür der Datscha, die jetzt eigentlich mehr einen
Kampfbunker darstellt. Die Tür steht einen Spalt breit offen. „Spieker! Ich
bin's, Dohrn!" Wieder keine Antwort.
Entschlossen, sich Klarheit zu
verschaffen, schiebt Dohrn den Lauf der Maschinenpistole zwischen Tür und
Angel, stößt dann die Tür mit einem Ruck auf. Gleichzeitig schnellt er nach
vorn und springt ins Innere.
Da die beiden Fenster
verrammelt sind und das Licht nur durch die Schlitze der Schießscharten in
den Raum dringen kann, herrscht diffuses Zwielicht, in dem nur schwer etwas zu
erkennen ist. Doch dann steigt Dohrn plötzlich ein Geruch in die Nase, der
ihn erschauern läßt. Hier riecht es nach Blut, Waffenöl und unsauberer
Kleidung.
Der Geruch des Todes! Welcher
Soldat kennt ihn nicht?
Spieker und die vier Männer
der MG-Bedienung liegen in ihrem Blut, festgefroren auf dem Boden, erstochen.
Der russische Überfall auf die Datscha muß ungemein listig und schnell
durchgeführt worden sein, denn Dohrn kann nicht die geringsten Kampfspuren
finden.
Waren die Kameraden, überfordert
durch die vorhergegangenen Kämpfe, eingeschlafen? Konnten sie deshalb von den
Russen überrascht und niedergemacht werden? Es muß so gewesen sein. Anders
kann sich Dohrn ihren schrecklichen Tod nicht erklären. Die Russen mußten in
Eile gewesen sein. Sie hatten nicht mal das sMG mitgenommen oder zerstört.
Sogar die Munitionskästen sind noch da, und in der Zuführung liegt ein
voller Gurt.
Trotz der grausigen Entdeckung
und des damit verbundenen Schocks handelt Unteroffizier Dohrn kaltblütig und
entschlossen. Den Kameraden hier ist nicht mehr zu helfen, aber die anderen in
der Stellung brauchen die Unterstützung durch das sMG.
Daß er selbst in größter
Gefahr schwebt, weil er zwar die Waffe bedienen und schießen, nicht aber zu
gleicher Zeit das Gelände ringsum kontrollieren kann, daran denkt Dohrn nicht
mehr.
Oberleutnant Koch zuckt überrascht
zusammen, als das sMG in der Datscha zu feuern beginnt. Es muß Dohrn sein,
der schießt. Die Soldaten der Kompanie sehen, wie die Geschoßgarben in die
russischen Angriffsreihen prasseln, die Gardeschützen reihenweise niedergemäht
werden, stürzen, durcheinandergeraten.
Das flankierende Feuer aus der
Datscha verschafft ihnen Luft und läßt
wieder einen Funken Hoffnung aufglimmen. Doch diese Hoffnung zerstiebt wenige
Minuten später wie Rauch im Wind.
Mitten in das Geschnatter der
feindlichen und eigenen Maschinengewehre hinein brüllen die Motoren der
Panzer am Waldrand auf. Die T 34 walzen das Gestrüpp nieder und rollen aus
der Deckung hervor. „Panzer! Die Panzer greifen an!"
Oberleutnant Kochs Hände
zittern, als er das Fernglas hält und zum Waldrand hinüberspäht.
Da kommen sie. Einer, zwei,
vier, sieben, neun, mit weißer Tarnfarbe angestrichene T 34!
Während die Panzer bei den
Grenadieren der Alarmeinheit Koch Schrecken und Angst verbreiten - im ganzen
Abschnitt gibt es weder Pak noch irgendeine panzerbrechende Waffe -, bricht
bei den Russen Jubel aus. „Urrä" brandet über die Ebene.
Koch läuft es kalt über den Rücken.
Neun T 34 - weitere werden noch im Wald stehen - und russische Infanterie
mindestens in Bataillonsstärke. Das kann nicht gut gehen !
Aber da ist noch die
Minensperre! Durch die müssen die T 34 hindurch, weil das Gelände rechts und
links davon nicht panzertragend und zudem so verweht ist, daß die Kampfwagen
steckenbleiben würden.
An dieses Hindernis klammern
sich siebzig Grenadiere und ein Oberleutnant.
Trotzdem gibt sich Koch keinen
Illusionen hin. Er kennt die Russen. Sie werden einen Moment stutzen, wenn der
erste Panzer in die Luft fliegt, aber es wird sie nicht daran hindern
weiterzufahren. Mögen drei, vier oder gar fünf T 34 drauf gehen, einige
werden es doch schaffen.
Die T 34 rollen an. Sie fahren,
immer zwei dicht nebeneinander, direkt auf die Minensperre zu.
Der neben Koch liegende
Obergefreite Beer, stellvertretender Kompanietruppführer, beißt vor Erregung
in seinen Wollfäustling. „Gleich kracht's, Herr Oberleutnant!"
prophezeit er. Dein Wort in Gottes Ohr, denkt Koch und blickt mit klopfendem
Herzen auf die durch den Schnee furchenden Panzer. Jetzt scheren sie in eine
Reihe ein, kommen nun hintereinander daher. Noch zwanzig Meter, zehn, fünf...
„Jetzt!" sagt der Obergefreite.
Doch nichts geschieht. Keine
Minenexplosion erschüttert die Luft. Die T 34 marschieren durch die
Minensperre, als wäre diese gar nicht da.
„Mein Gott, das gibt es doch
nicht", stöhnt Beer mit leichenblasser Miene. „Das ist doch nicht möglich,
Herr Oberleutnant! Wenn ich nicht genau wüßte, daß unsere Pioniere über
zweihundert Minen verlegt haben..."
„Haben sie auch, Beer. Aber
die Iwans haben heute nacht eine Minengasse geräumt..."
Beer hat Tränen der Wut in den
Augen.
„Los, laufen Sie zurück zu
den Granatwerfern", befiehlt der Oberleutnant. „Möglich soll vier Schuß
ins Minenfeld setzen. Aber rasch, Mann!"
Der Obergefreite wetzt los.
Knapp zwei Minuten später rauschen die Werfergranaten über die Köpfe der
Grenadiere hinweg und schlagen mitten im Minenfeld ein. Fast zur selben Zeit
gehen vier oder fünf T-Minen hoch.
Nun weiß Oberleutnant Koch mit
absoluter Gewißheit, daß die Russen während der Nacht im Minenfeld waren.
Es ist 9.10 Uhr, als die T 34
des russischen Kampfgruppenkommandeurs, Major Sipjadom, in die Stellungen
der Alarmkompanie des Oberleutnants Koch einbrechen. Hinter ihnen kommen die
Gardeschützen, schlüpfen durch die Minengasse, immer in Deckung der Panzer,
während die Pioniere Sipjadoms, gedeckt vom Feuer der MG und Panzer, die
Gasse verbreitern.
Noch halten Oberleutnant Kochs
Grenadiere die Stellung, hämmern die MG, kämpfen diese armen Teufel mit dem
Mut der Verzweiflung und werfen einen Trupp Rotarmisten, die es zu eilig
hatten, aus einem Grabenstück heraus. Doch dann sind die Panzer da, drehen
ein, rasseln über die Gräben und Deckungslöcher hinweg.
„Panzer von links! - Panzer
von vorn!"
Schreie, gellende Warnrufe. Die
T 34 überrollen die Deutschen, und nicht einer von ihnen kommt dazu, die Hände
zu heben, um sich zu ergeben. Manch einer hat das Glück, daß die Grabenwände
nicht einbrechen, dann fährt der schreckliche Tod noch einmal an ihm vorüber.
Der Kampf der Alarmkompanie
Koch ist kurz, grausam und hoffnungslos. Es wird ein Gemetzel, wie es
furchtbarer nicht sein könnte. Beide Seiten kämpfen mit allen Waffen, die
ihnen zur Verfügung stehen.
Bei dem Versuch, einen T 34 mit
geballter Ladung zu erledigen, fällt Oberleutnant Koch. Ein Wachsamer
russischer MPi-Schütze streckt den deutschen Oberleutnant mit einer Salve
nieder. Koch wankt noch einige Schritte weiter, jagt eine Garbe aus seiner MPi
in eine Gruppe Rotarmisten, dann bricht er zusammen. Die Gleisketten eines T
34 walzen ihn in den Schnee.
Die „Operation Scheidiswald"
ist für den russischen Major Sipjadom so gut wie gelaufen. Der Durchbruch ist
geschafft. Die Siegesmeldung kann an die 268. Schützendivision abgehen.
Feindliche Widerstandslinie
ostwärts Geländepunkt 7779 durchbrochen. Kein Widerstand mehr. Erbitte
weitere Befehle. -
Dieser Funkspruch, der Eile
wegen im Klartext abgegeben, wird - wie so viele andere russische Funksprüche
auch - vom Abhördienst des XXVI. Armeekorps aufgefangen und dem Ic übermittelt.
So alarmierend er ist, erregt er dennoch keine Panik mehr. Er war nur eine
von Dutzenden Hiobsbotschaften und Meldungen, die das Korps an diesem 13.
Januar 1943 erreichten.
Hoffnungsloser, als die Lage im
„Flaschenhals" von Schlüsselburg im Moment ist, kann sie nicht mehr
werden. Der heutige und vielleicht noch der
morgige Tag werden die Entscheidung darüber bringen, ob die 18. Armee in der
Lage sein wird, die gewaltige sowjetische Newa-Offensive abzufangen.
Im Kampfraum der 170. ID läuft
seit einer halben Stunde der Gegenangriff der 96. ID. Schon rollen die vier
„Tiger"-Panzer in den Durchbruchsraum nordöstlich von Gorodok, jagt
die schwere Abteilung des Flakregiments 36 mit ihren 8,8-cm-Geschützen in die
bedrohte Ecke. Die Grenadierbataillone General Noeldechens, voran das GR 284,
haben ebenfalls schon Feindberührung.
Das winterliche Duell in den
Torfmooren südlich der Newa und vor den Sinjawino-Höhen hat erst begonnen,
in dessen Verlauf auf deutscher Seite statt vier Divisionen insgesamt zwölf
zum Einsatz gebracht werden müssen.
Am Ende wird es weder Sieger
noch Besiegte geben, dafür aber Tausende und aber Tausende von Verwundeten
und Toten auf beiden Seiten...
Quelle: Veteran 170.
Infanterie Division für die Zeitschrift Landser geschrieben.









Wichtiger Hinweis: Diese Seite
verherrlicht nicht die Ereignisse des 2. Weltkriegs, sie soll rein objektiv den
Verbleib meiner Verwandten schildern.
COPYRIGHT © 2008 ostvermisste-1944 /H.F.
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und
Verbreitung sowie Übersetzung. Kein Teil dieser Homepage darf in irgendeiner
Form ohne schriftliche Genehmigung von Hagen Friedrich reproduziert werden oder
unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder
verbreitet werden.
